Der Altenberger Dom

Vorderseite
des Altenberger Domes, Photographie von H. M. Knechten
Ist das Bergische Land nach der hügeligen Gegend benannt? Nein,
sondern nach dem Territorium der Grafen von Berg.
Adolf III. von Deutz (um 1025 - 1081/1083) erbaute um 1060
die Burg Berge, daher wurde er in einer Urkunde von 1068 als Adolfus advocatus
de Monte (Adolf [I.] genannt von Berg) bezeichnet.
1122 erbaute Graf Adolf II. von Berg (1106 - 1160) hoch über
der Wupper eine Burg im heutigen Solingen, die er Neuenberge nannte zur
Unterscheidung von Altenberge im heutigen Odenthal. Im Jahre 1386 bezogen
Herzog Wilhelm I. von Berg (um 1348 - 1408) und seine Gemahlin Anna von der
Pfalz (1346-1415) ihre neue Residenz in Düsseldorf, eine Burg am Rhein, sodaß
die Bedeutung von Berge allmählich sank. Um 1500 wurde es allmählich zu einem
Schloß umgebaut, sodaß die Bezeichnung Schloß
Burg üblich wurde. Es erlitt schwere Schäden im Dreißigjährigen Krieg und
wurde 1648 niedergelegt. Ab 1890 erfolgte der Wiederaufbau. Heute ist Schloß
Burg die größte rekonstruierte Burganlage in Nordrhein-Westfalen.

Innenraum
des Altenberger Domes, Photographie von H. M. Knechten
1133 verschenkte Adolf II. Altenberge an die Zisterzienser
von Morimond. In deutschen Quellen hieß diese Gründung: Kloster zum alten
Berge, und in lateinischen: Monasterium sanctæ Mariæ de Berge.

Altarraum
des Altenberger Domes, Photographie von H. M. Knechten
Es bestanden bereits familiäre Bindungen zum
Zisterzienserorden durch Adolfs Bruder Everhard von Berg (um 1100 - 1145/1152),
der zwischen 1120 und 1124 in Marimord dem Orden beigetreten war. Adolfs
zweiter Bruder Bruno II. von Berg (um 1100 - 1137) war seit 1131 Erzbischof von
Köln.
Die Mönche wohnten ein Jahr lang in der Burg Berge und zogen
dann in das Tal um. Der Grund war die Nähe zum Fluß Dhünn. Wasser war notwendig
als Trink-, Spül- und Waschwasser, außerdem, um die Kornmühle anzutreiben und
den Unrat wegzuschwemmen. Im Übrigen war es Sitte der Benediktiner, Klöster auf
Bergen zu gründen, da dieser Orden zur unruhigen Zeit der Völkerwanderung
gegründet wurde, also Schutz und Sicherheit vonnöten waren, während die
Zisterzienser Täler bevorzugten, da sie im Grunde fromme Gärtner und zugleich
Lehrende und Lernende waren.

Strahlenmadonna
des Altenberger Domes, um 1530, Photographie von H. M. Knechten
Woher kommt die Bezeichnung Zisterzienser? 1098 wurde in Cîteaux (altfranzösisch cistels – Röhricht) ein Kloster
gegründet. Der Ort liegt 25 km südlich von Dijon in der Region Burgund. Das
Ziel war, die benediktinische Regel wörtlich zu befolgen. Als Bernhard von
Clairvaux (1090-1153) im Jahr 1113 zusammen mit dreißig Freunden in den Orden eintrat,
setzte eine Blüte ein, sodaß viele weitere Klöster gegründet wurden. Das
Kloster Morimond, gegründet 1115 in Parnoy-en-Bassigny (40 km ostsüdöstlich von
Chaumont, Département Haute-Marne) von Stephan Harding, dem dritten Abt von
Cîteaux (um 1059 - 1134), sandte Abt Berno (1135-1151 urkundlich erwähnt) und
zwölf Mönche nach Altenberg, welche dort am 25. August 1133 eintrafen und ein
Kloster gründeten.
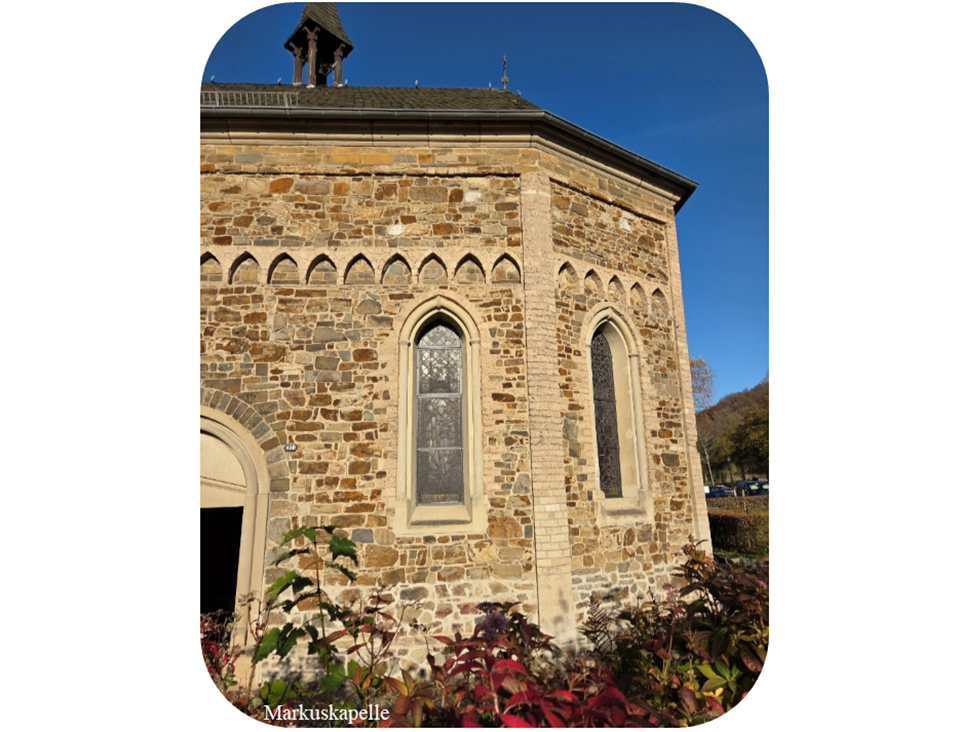
Die
Markuskapelle stammt aus dem Jahre 1225 und ist somit das älteste erhaltene
Gebäude in Altenberg. Photographie von H. M. Knechten.
Sie erbauten im Tal eine romanische Kirche, die um 1160
geweiht wurde. Im Jahr 1198 gab es im Kloster bereits 107 Mönche, drei Novizen
und 338 Konversen (Laienbrüder). 1222 stürzte die Kirche bei einem Erdbeben
ein.

Das
Innere der Markuskapelle, Photographie von H. M. Knechten
Zur Überbrückung wurde 1225 die Markuskapelle erbaut. Dies
ist das älteste original erhaltene Gebäude Altenbergs.
Für das Jahr 1225 ist ein Ereignis zu verzeichnen, das die
Zeitgenossen erschütterte. Beginnen wir mit einigen Angaben zur Person, um die
es hier geht!
Engelbert II. von Berg wurde 1185/1186 auf der Burg
Neuenberge geboren. 1199 wurde er zum Kölner Dompropst gewählt. Sein
Gegenkandidat, Dietrich von Hengebach (um 1150 - 1224) stritt mit ihm vier
Jahre lang bei der Kurie um die Rechtmäßigkeit der Wahl, bis die römische
Behörde 1204 eine Neuwahl anordnete, bei welcher Dietrich verlor. Dompropst
Engelbert gab seinem Onkel, Adolf von Altena (um 1157 - 1220), Güter des Kölner
Domstiftes in die Hand. Dieser war als Adolf I. von 1193 bis 1205 Erzbischof
von Köln, während er von 1212 bis 1216 dieses Amt nur provisorisch verwaltete.
Wer geduldig bis zu diesem Abschnitt gelesen hat, mag wohl
ob der Fülle der Daten einen Seufzer gen Himmel gesandt haben. Diese Geschichte
ist wahrlich kompliziert! Immerhin gehört sie zu den Verwicklungen, in welche
die Grafen von Berg gerieten, und so soll jetzt gefragt werden, warum Adolf I.
1205 sein Amt verlor.
Er hatte 1198 den Welfen
Otto von Braunschweig in Aachen zum deutschen König gekrönt. Dies gefiel Papst
Innozenz III., da hiermit die Macht der Staufer
in Italien geschwächt wurde. Das Auftreten Ottos führte allerdings zu einer
Distanzierung. Adolf I. wandte sich nun dem Staufer Philipp von Schwaben zu,
der ihn dafür reich belohnte. Adolf krönte Philipp 1205 zum König, obwohl sich
der Papst die Entscheidung, wer als König regieren wird, selbst vorbehalten
hatte.
Durch dieses Doppelkönigtum entstand ein Bürgerkrieg, der
unter anderem auch dem Kölner Domkapitel Schaden zufügte.
Innozenz III. war über den Seitenwechsel Adolfs irritiert
und bat ihn um eine Stellungnahme, die Adolf verweigerte, da er sein mühsam
erkämpftes Recht der ausschlaggebenden Stimme bei der Königswahl nicht von
einer päpstlichen Entscheidung abhängig machen wollte. Mit dieser Einstellung
hatte Adolf seine eigene Bedeutung bei weitem überschätzt; er wurde vom Papst
seines Amtes enthoben und gebannt.
Das waren aufregende Zeiten; es kommt aber noch ärger.
Papst Innozenz III. (1161-1216) setzte im Jahre 1206 auch
Engelbert wegen seiner Unterstützung der prostaufischen Position Adolfs als
Dompropst ab, bannte und exkommunizierte ihn. 1208 wurde er begnadigt.
1212 nahm Engelbert mit seinem Bruder Graf Adolf III. von
Berg (1175-1218) für 60 Tage am Albigenserkreuzzug teil, der insgesamt von 1209
bis 1229 dauerte. Die Katharer (die Reinen) wirkten in der französischen Stadt
Albi und wurden daher Albigenser genannt. Durch den Sieg über diese
Glaubensgemeinschaft, welche ein asketisches, armes und klerikerfreies
Christentum angestrebt hatte, wurde Okzitanien in den Herrschaftsbereich der
französischen Könige eingegliedert.
Von 1212 bis 1216 hatte sein Onkel Adolf I. die
provisorische Leitung des Erzbistums Köln inne. Sein Kontrahent, Dietrich von
Hengebach, der mit Engelbert von 1199 bis 1204 vor der Kurie um das Amt des
Dompropstes gestritten hatte und dann als Dietrich I. von 1208 bis 1212
Erzbischof von Köln war, verlor dieses Amt und wurde exkommuniziert, weil er
sich geweigert hatte, die Exkommunikation des Kaisers Otto IV. zu verkünden,
doch er stritt drei Jahre vor der Kurie um sein Recht, weiterhin Erzbischof von
Köln sein zu können. 1215 ordnete die Kurie eine Neuwahl in Köln an, bei
welcher das Votum auf den Neffen Adolfs fiel.
1216 wurde er als Engelbert I. Erzbischof von Köln, da er
sich in der voraufgehenden Zeit sowohl gegen Welfen wie auch gegen Staufer
neutral verhalten hatte. Nachdem Engelbert dem Kölner Domkapitel die Schäden
ersetzt hatte, die ihm während des Bürgerkrieges entstanden waren, erhielt er
von Papst Honorius III. (um 1148 - 1227) im Jahre 1218 das Pallium als Zeichen
der Metropolitenwürde. (Das Pallium ist eine Art Stola, die über dem Meßgewand
getragen wird und sechs schwarze Seidenkreuze aufweist.)
Als Adolf III. von Berg im Jahre 1218 auf einem Kreuzzug in
Damiette (Ägypten) starb, beanspruchte Engelbert das Erbe der Grafschaft von
Berg für sich, obwohl Irmgard von Berg (1204-1248/1249), die Frau des Herzogs
Heinrich IV. von Limburg (1200-1246), erbberechtigt gewesen wäre. Engelbert
setzte sich aber militärisch durch.
1222 krönte Engelbert Heinrich VII. (1211-1242) in Aachen
zum König. Zu dieser Zeit war Engelbert als Leiter und Provisor des Deutschen
Reiches (gubernator et provisor regni teutonici) sowie als Vormund Heinrichs
die politisch einflußreichste Person des Heiligen Römischen Reiches. Er war
Herzog von Niederlothringen, Herzog von Westfalen und Graf von Berg. Er war an
der Ausprägung des kurfürstlichen Wahlkönigtums sowie der territorialen
Landesherrschaft mit Markt-, Münz- und Befestigungsrecht maßgeblich beteiligt.
Er verlieh 13mal das Stadtrecht und stärkte sein Herrschaftsgebiet zwischen
Maas und Weser sowie im Herzogtum Westfalen. Mit den Burgen und Städten
Attendorn, Bochum, Brilon, Geseke, Helmarshausen, Herford, Medebach,
Obermarsberg, Padberg, Rütten, Siegen, Volkmarsen, Werl, Wiedenbrück und
Wipperfürth verfügte er über Herrschaftsinseln, die in der Zukunft zu einem
geschlossenen Herrschaftsgebiet zusammenwachsen sollten. Engelbert legte damit
die Grundlage für das Kölnische Territorium, indem er personenbezogene in
flächenbezogene, pluriforme und diffuse in uniforme und geschlossene
Organisationsstrukturen wandelte. Dafür folgt ein Beispiel: 1223
übertrug Engelbert die mächtige Vogtei Siegburg von der Grafschaft Berg auf die
Erzdiözese Köln. Er war außerdem Vogt von Deutz, Cappenberg und Werden.
Sowohl der Erzbischof von Köln als auch Friedrich von
Isenberg (1193-1226) versuchten, ihr Territorium ins Münsterland hinein
auszudehnen.
Friedrichs Herrschaft beruhte hauptsächlich auf
Kirchenvogteien. Er war Vogt bedeutender Klöster und Stifte, wie die Kleine und
Große Vogteirolle belegen. Engelbert betrieb eine Entvogtungspolitik, welche
Friedrichs Einkommen schmälerte.
Engelbert hatte sich im Laufe der Zeit mächtige Feinde
geschaffen: Er hatte den Herzog von Limburg (heute Provinz Lüttich) in seinem
Recht auf die Grafschaft Berg übergangen, den Bischof von Münster durch sein
territoriales Vordringen bedroht, die Domherren von Paderborn durch seine
Einmischung in eine Bischofswahl und durch seine Einkreisungspolitik vor den
Kopf gestoßen, den Aufstand der Ministerialen von Utrecht gegen ihren Bischof
unterstützt und versucht, Friedrich von Isenberg zu schwächen. Außerdem zählten
zu Engelberts Gegnern die Herren von Arnsberg, Kleve, Schwalenberg (Oldenburg
bei Marienmünster) und Tecklenburg sowie der Grafschaft Lippe. Die erwähnten
Adligen waren nicht länger bereit, dies hinzunehmen, und fanden sich zu einer
Fronde (Adelsverschwörung) zusammen. Dies ist die Ursache für das folgende
Ereignis.
Adelheid, die etwa von 1216 bis 1227 Äbtissin und von 1228
bis 1237 Fürstäbtissin des Stiftes Essen war, hatte sich wiederholt bei
Engelbert beklagt, daß ihr Vogt, Friedrich von Isenberg, die Abtei und ihre
Besitzungen nicht schütze, wie es seine Aufgabe gewesen wäre, sondern sie
rücksichtslos finanziell auspresse.
Am 6. November 1225 traf sich Engelbert mit Friedrich von
Isenberg zu einer Verhandlung in Soest, bei der Engelbert durchzusetzen
versuchte, daß Friedrich die Vogtei Essen dem Erzbistum Köln überlasse. Als
Gegenleistung solle Friedrich eine Pension erhalten, doch er lehnte dies ab,
sodaß die Verhandlung ergebnislos abgebrochen wurde. Dies ist der Anlaß für
das, was jetzt folgt.
Engelbert machte sich auf den Weg, um in Schwelm eine neu
erbaute Kirche zu weihen. Am 7. November 1225 wurde er in einem Hohlweg in der
Nähe des heutigen Gevelsberg von Dienstleuten des Grafen Friedrich von Isenberg
erschlagen. Friedrich hatte möglicherweise Engelbert nur gefangen nehmen
wollen, um ein Lösegeld zu erpressen, was zu dieser Zeit häufig geschah. Da
sich der 1,80 m große Bischof aber heftig wehrte, gelang dies nicht.
Sein geflohenes Gefolge kehrte an den Ort seiner Ermordung
zurück und versuchte, seinen Leichnam in Schwelm aufzubahren, doch der dortige
Pfarrer ließ dies nicht zu, damit die neu erbaute, noch ungeweihte Kirche nicht
durch einen Ermordeten für kultische Zwecke untauglich werde. Außerdem
fürchtete er die Rache Friedrichs von Isenberg.
Selbst die Tore seines Geburtsortes Neuenberge schlossen
sich; denn Engelbert hatte die Herzöge von Limburg düpiert, indem er ihnen die
Herrschaft über die Grafschaft Berg verweigerte. Außerdem fürchtete die
Burgbesatzung den Nachfolger auf dem erzbischöflichen Stuhle, Heinrich von
Müllenark (um 1190 - 1238), der ein erbitterter Gegner Engelberts war.
Schließlich erklärten sich Mönche des Zisterzienserklosters
Altenberg bereit, den Leichnam zu waschen und für die Bestattung vorzubereiten.
In der Scheitelkapelle (der mittleren Kapelle des Kapellenkranzes
um den Altarraum, am Scheitel der Apsis) des Altenberger Doms ist das Herz
Engelberts in einem rechteckigen Reliquiar hinter der Mitte des Altares, das in
seiner heutigen Gestalt von Ernst Riegel im Jahre 1939 gefertigt wurde, während
seine Gebeine in den Turm des alten Domes von Köln verbracht wurden; heute
ruhen sie in einem barocken Schrein im Domschatz.
Friedrich von Isenberg wurde für den Tod seines Onkels
zweiten Grades verantwortlich gemacht. Der neue Erzbischof von Köln, Heinrich
I. von Müllenark, der das Erzbistum von 1225 bis 1238 regierte, und Graf Adolf
I. von der Mark (vor 1182 - 1249) belagerten im Winter 1225/1226 die Isenburg
(beim heutigen Hattingen) und zerstörten sie.
Am 13. November 1226 wurden Friedrich am Severinstor zu Köln
Arme und Beine gebrochen, dann wurde er auf ein Rad geflochten, das auf einer
Steinsäule befestigt wurde, sodaß das qualvolle Sterben des Delinquenten allen
gut sichtbar war. Er starb am folgenden Tage. Sein Leichnam wurde den Vögeln
zum Fraß überlassen.
Und wenn das Rad der Bürger sieht,
Dann läßt er rasch sein Rößlein traben,
Doch eine bleiche Frau die kniet,
Und scheucht mit ihrem Tuch die Raben:
Um sie mied er die Schlinge nicht,
Er war ihr Held, er war ihr Licht –
Und ach, der Vater ihrer Knaben!
(Annette von Droste Hülshoff, Der Tod des Erzbischofs
Engelbert von Cöln, in: Das malerische und romantische Westphalen,
herausgegeben von Ferdinand Freiligrath und Levin Schücking, Barmen und Leipzig
1841, 226-230, hier 230.)
In der Folgezeit erlangten die Gegner Engelberts eine gewisse
Selbständigkeit. Sie erhielten das Recht zum Burgenbau und zur Stadterhebung,
blieben aber dem Erzbistum Köln gegenüber loyal.
Dies kann man nicht von einem weit gefährlicheren Gegner des
Erzbistums Köln sagen, dies war der Graf von der Mark. Seine Machtposition war
nach 1225 deutlich gestärkt.
Der jetzige Altenberger Dom wurde 1259-1379 erbaut.
Auffällig sind die Strebepfeiler, welche ein erneutes Einstürzen verhindert
haben, da sie die Scherkräfte der Strebebögen aufnehmen.
Der Dom besteht aus Drachenfelser Trachyt, der schwieriger
hierhin zu transportieren war als zum Kölner Dombau, der elf Jahre zuvor,
nämlich im Jahre 1248, begonnen worden war. Der Altenberger Dom ist eine der
größten Kostbarkeiten gotischer Baukunst in Deutschland.
Im 13. Jahrhundert
hatten die Priestermönche einen eigenen Kreuzgang, der im Osten lag. Der
kleinere und ältere Kreuzgang im Westen diente den Konversen.
Infolge des Reichsdeputationshauptschlusses 1803 wurde der
Dom säkularisiert und das Inventar verkauft. Im Kloster wurde eine Chemiefabrik
für Berliner Blau eingerichtet. Nach einer Explosion in der Nacht vom 6. auf
den 7. November 1815 im Bereich des Kapitelsaales brach ein Feuer aus, das die
Klostergebäude zerstörte und auf das Dach des Domes übergriff. In der Folgezeit
stürzten Teile des Mauerwerkes ein. Die Gebäude dienten danach als Steinbruch.
1835-1846 wurde der Dom restauriert und 1895 vollständig
wiederhergestellt.
Aufgrund einer Kabinettsorder des Königs Friedrich Wilhelm
IV. ( 1795-1861) dient der Dom seit 1857 zugleich der evangelischen wie auch
der katholischen Gemeinde Altenbergs.
Es handelt sich um eine dreischiffige Basilika mit
Querschiff. Ein Dachreiter ersetzt den Kirchturm. Einfache Säulen tragen die
Obergaden. Auf jeden überflüssigen Schmuck wurde verzichtet: Nichts soll vom
Gebet ablenken. Erst in den folgenden Jahrhunderten vermehrten sich die
Kunstwerke sowie die Grabstätten Adliger.
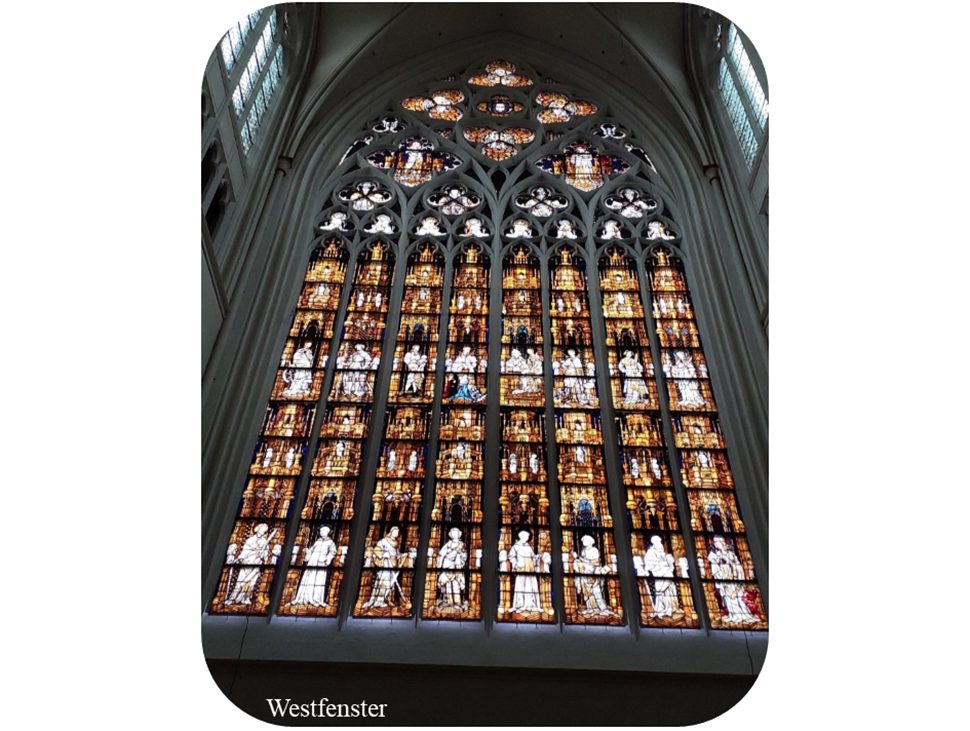
Altenberger
Dom, Gesamtansicht,
Photographie von H. M. Knechten
Vor 1397 entstand das größte in Deutschland erhaltene
mittelalterliche Kirchenfenster (8 x 18 m). Es befindet sich an der
Eingangsseite im Westen und stellt das Himmlische
Jerusalem dar: „Er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott
her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes“ (Offb 21,
10f).
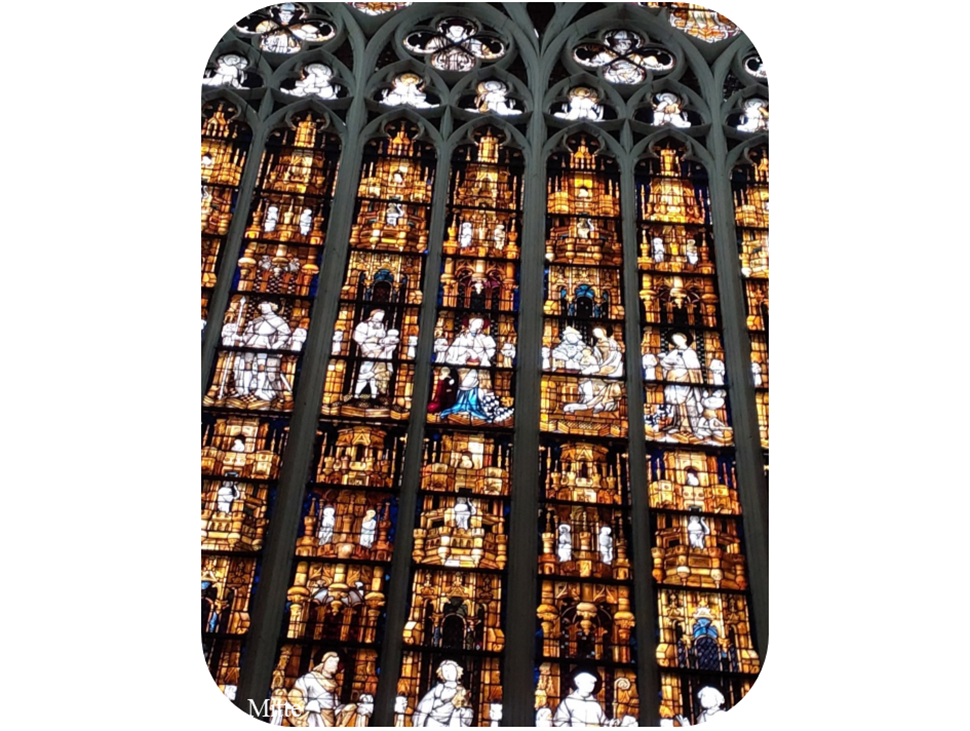
Westfenster,
Mitte, Photographie von H. M. Knechten
Oben ist Christus dargestellt, umgeben von vier Engeln.
Darunter Maria, der ein Schwert in der Brust steckt (Lk 2, 35: „Dir selbst aber
wird ein Schwert durch die Seele dringen“) und ein nachsinnender, betroffener
Johannes der Evangelist, dann die großen lateinischen Kirchenlehrer Gregor der
Große, Hieronymus, Augustinus und Ambrosius, darunter musizierende Engel. Es
folgen eine Reihe Heiliger: Katharina von Alexandrien mit dem Attribut des
Rades, Gereon, Johannes der Täufer, Elisabeth mit Stifterin, Heilige Familie,
Maria mit Stifter, Stephanus und Barbara. In der unteren Reihe sind
dargestellt: Alban, Bernhard von Clairvaux, Andreas, Johannes der Evangelist,
Benedikt, Petrus, Paulus und Norbert von Xanten.
Elisabeth
von Thüringen, Rosenwunder, musizierende Engel, Stifterin Anna von der Pfalz /
Anna von Berg (1346-1415)
Das Lettnergitter von 1644 trennte ursprünglich den
Mönchschor ab; heute steht es im Eingangsbereich des Domes. Links ist Moses,
rechts Bernhard von Clairvaux, Mitte des 17. Jahrhunderts.
Im südlichen Seitenschiff Maria Immaculata und Märtyrerinnen
vom barocken Hochaltar, 1655. Nördlich der Kanzelkorb von 1602 aus der
Michaeliskapelle Oberwesel.
In der Dreikönigenkapelle ist die Darstellung der Anbetung
der Drei Könige zu sehen, die um 1570 entstanden war. Außen an der Kapelle
befinden sich Glasmalereien aus dem zerstörten Kreuzgang des Klosters, um 1510
- 1530, mit Szenen aus dem Leben des heiligen Bernhard von Clairvaux: die
Krankenheilung in Lüttich und die Darstellung seines Todes. Ursprünglich waren
es 115 Scheiben in 11 Fenstern. An der Säule befindet sich ein Christophorus
vom Ende des 16. Jahrhunderts.
In der Taufkapelle über dem Altar ist die Verkündigung an
Maria, Ende des 14. Jahrhunderts, ursprünglich am Westportal.
Im Herzogenchor ist die Grablege von Graf Adolf II. (†
1160/1170), dem Stifter des Klosters Altenberg.
Im Chorumgang ist ein Tafelbild mit der Kreuzigung Christi,
um 1570. Die Grablege des Kölner Erzbischofs Friedrich II. († 1163). Im Chor
sind Grisaillefenster.
Über den Stufen hängt die Altenberger Madonna im
Strahlenkranz als Doppelfigur, um 1530. Sie bekrönte früher einen
Marienleuchter.
Im Chor gab es ursprünglich hundert Sitze. Das Chorgestühl
war reich mit Figuren und Blattwerk versehen. Die wenigen Originalfragmente,
die nach der Säkularisation erhalten sind, befinden sich im Kunstgewerbemuseum
Berlin. Bei dem heutigen Chorgestühl handelt es sich um eine Nachbildung.
Nur die Kapitelle im Chor sind mit Blattwerk verziert.
Im Hohen Chor ist das Sakramentshaus von Walter Schlebusch
aus dem Jahre 1490 aus Flötenstein (Phonolit-Lava aus der Eifel). In der Höhe
der Gittertürchen finden sich kleine Apostelfiguren. Eine Kreuzblume bekrönt
das Sakramentshaus; auf ihr ist die Skulptur eines Pelikans, der sich die Brust
aufreißt, um seine Jungen zu nähren. Dies ist ein Symbol für den Erlöser, der
sein Leben hingab, um uns zur Auferstehung zu führen. In Wirklichkeit holen
sich die Jungen ihr Futter tief aus dem Kehlsack der Eltern, was den Eindruck
hervorruft, sie würden sich von deren Fleisch ernähren.
Über dem Hochaltar hängt das Triumphkreuz aus der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts; das Leiden des Gekreuzigten ist nur verhalten
dargestellt, während der Sieg über den Tod überwiegt.
Rechts steht der Osterleuchter aus dem 13. Jahrhundert.
Die Orgel der Firma Klais wurde 1980 erbaut, 2005 renoviert
und erweitert. Sie verfügt über 85 Register, die sich auf Rückpositiv,
Hauptwerk, Schwellwerk, Brustwerk, Trompeteria und Pedal verteilen.
Spieltisch
und Orgel
Hier war ursprünglich der Zugang zum östlichen
Kreuzgangsflügel mit Kapitelsaal, Refektorium und Dormitorium. Seit 2012 wurden
Ausgrabungen durchgeführt.
Altenberger
Dom und Haus Altenberg
1925
1863 errichtete das Erzbistum Köln ein Pfarrhaus, die
Erzbischöfliche Villa. 1922 pachtete der Generalpräses des Katholischen
Jungmännerverbandes, Carl Mosterts (1874-1926), das Gelände und die Aufbauten
um den Dom. Er wollte ein Erholungs- und Ferienheim für ehemalige Soldaten des
Ersten Weltkrieges gründen, doch es brach in dem Konversenflügel neben dem
Haupteingang des Domes ein Brand aus. Eine Werkschar Ehrenamtlicher ging an den
Wiederaufbau, der sich an die früheren Abteigebäude anlehnte. In den fertiggestellten
Räumen trafen sich Jugendgruppen zur Erholung und Fortbildung. So entstand Haus
Altenberg, das 1933 fertiggestellt wurde.
Carl Mosterts starb am 25. August 1926. Seit dem 9. November
1926 leitete Ludwig Wolker (1887-1955) dieses Haus. Es ging ihm um eine
Verknüpfung von Jugendseelsorge und Ausbildung zur Gruppenleitung. Seit 1935
wurde nur noch eine rein religiöse Betätigung geduldet. Nun entwickelte sich
Altenberg noch stärker zum Wallfahrtsort. Lichterprozessionen und Feierstunden
prägten diese Zeit. 1935 dichtete Georg Thurmair (1909-1984) das Altenberger
Lied, das von Adolf Lohmann (1907-1983) vertont wurde: „Nun, Brüder, sind wir
frohgemut“. Zwölfmal durchsuchte die Geheime Staatspolizei das Haus und 1942
wurde es beschlagnahmt.
1946 gründete Ludwig Wolker den Verlag Haus Altenberg, 1947
den Bund der deutschen katholischen Jugend und 1948 das Altenberger Singewerk.
Der Christophorusverlag veröffentlichte in diesem Jahr das Altenberger
Singebuch, getreu nach dem Motto: Eine singende Bewegung ist eine siegende
Bewegung.
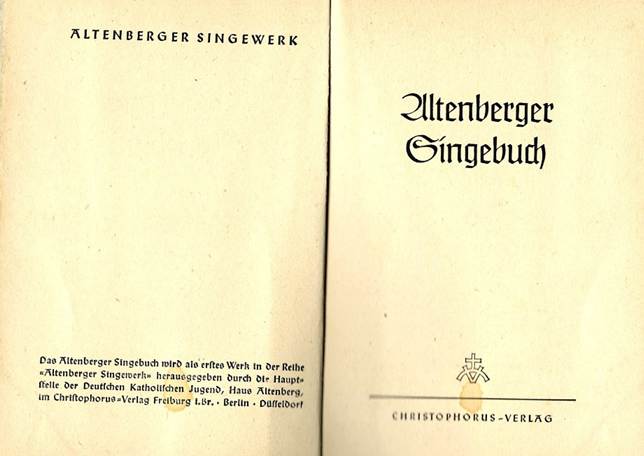
Altenberger
Singebuch, Freiburg im Breisgau 1948
Winfried Pilz, der von 1972 bis 1990 Haus Altenberg leitete,
schuf Pfingsten 1975 auf der Textgrundlage des Sonnengesanges Franziskusʼ
von Assisi und mit einer italienischen Melodie das Lied Laudato si (Gelobt sei), das in den folgenden Jahrzehnten viel
gesungen wurde. Als im Jahre 2022 Mißbrauchsvorwürfe gegen Pilz bekannt wurden,
erhob sich die Forderung, dieses Lied nicht mehr zu singen.
Das Altenberger Licht ist eine Lichtstafette des Friedens,
die seit 1950 jährlich am 1. Mai im Altenberger Dom beginnt. Anlass war der
Wunsch nach Versöhnung.
Was macht Altenberg so anziehend? Es handelt sich um einen
kleinen Ort, der abgeschieden liegt. Die hügelige Landschaft hat ihren Reiz. Es
ist möglich, die zahlreichen Kunstwerke im Dom in aller Stille zu betrachten
und in sich aufzunehmen. Hier kommt die Seele zur Ruhe.
Unternimm es und schenke dich dir selbst, ich will nicht
sagen, immer oder häufig, aber doch wenigstens ab und zu. Wenn viele Menschen
etwas von dir mitnehmen, so sollst du auch zwischendurch etwas von dir selbst
haben. Widme dich nicht ständig deinen zahlreichen Aufgaben, lasse dich von
deinen Sorgen nicht auffressen, sondern besinne dich auf dich selbst. (Bernhard
von Clairvaux, Über die Selbstbesinnung an Papst Eugen [III.; um 1080 - 1153],
S. Bernardi opera, herausgegeben von Jacques Leclercq, Band 3, Rom 1963, Buch
I, Kapitel 5).

Fassade
des Altenberger Domes, Photographie von H. M. Knechten

Westfenster
des Altenberger Domes, Christophorus trägt Christus, Photographie von H. M.
Knechten
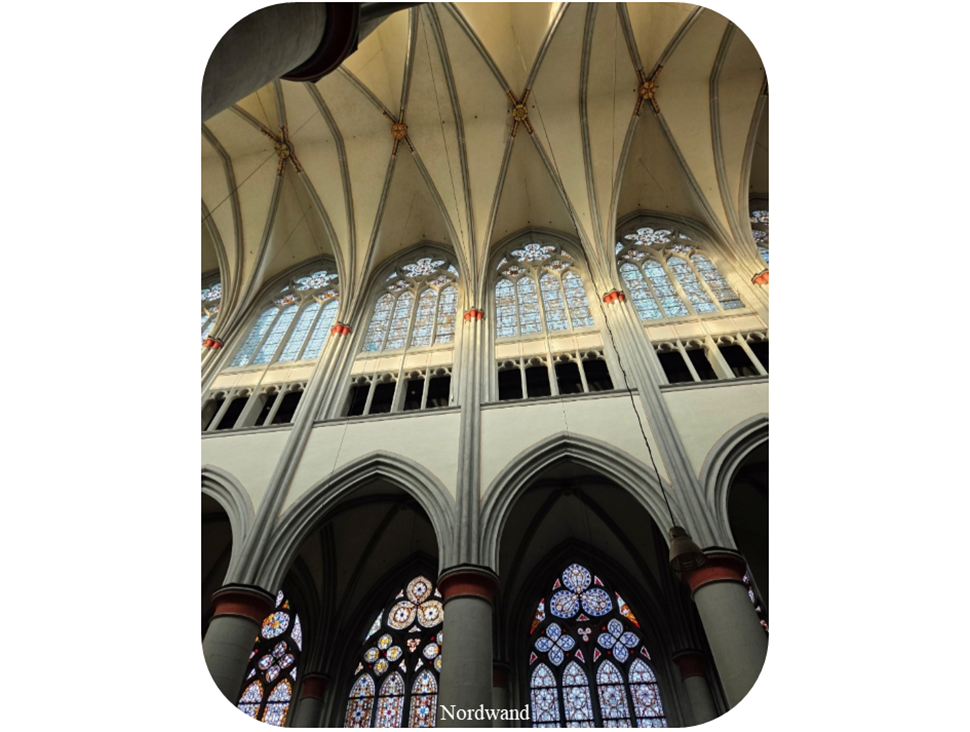
Nordwand
des Altenberger Domes, Photographie von H. M. Knechten
Bibliographie
Quellen
o Cæsarius von Heisterbach (um 1180 - 1240), Vita et actus domni Engilberti Coloniensis archiepiscopi et martiris, herausgegeben von F. Zschaeck, Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Band 43, Bonn 1937.
o Die große Vogteirolle des Grafen Friedrich von Isenberg-Altena um 1220. Stift Essen, herausgegeben von Moritz Graf zu Bentheim Tecklenburg Rheda, Veröffentlichung aus dem Fürstlichen Archiv zu Rheda, Rheda 1955. (Moritz Casimir zu Bentheim-Tecklenburg lebte von 1923 bis 2014.)
o Die kleine, ältereVogteirolle der Grafen Isenberg-Altena, vor 1220. Einführung und Beschreibung, Abschrift der Pergamentrolle, Ortsregister, Tabellen, herausgegeben von Moritz Graf zu Bentheim Tecklenburg Rheda, Veröffentlichung aus dem Fürstlichen Archiv zu Rheda, Rheda 1957.
o
Mosler, Hans (1879-1970), Urkundenbuch
der Abtei Altenberg, Urkundenbücher der geistlichen Stifte des Niederrheins,
Bände 3, 1f, 1. Band (1138-1400), Bonn 1912, 2. Band (1400-1803), Düsseldorf
1955.
Literatur
o
Altenberger Singebuch, herausgegeben
von Adolf Lohmann (1907-1983), Johannes Theissing (1912-1947) und Hans Kulla
(1910-1956), Altenberger Singewerk, Band 1, Freiburg im Breisgau 1948.
o
Binding, G., Anmerkungen zur Frühzeit
des Zisterzienserklosters Altenberg, Jahresgabe des Altenberger Dom-Vereins,
Bergisch Gladbach 2012.
o
Binding, G., L. Hagendorf u. N.
Nußbaum, Das ehemalige Zisterzienserkloster Altenberg, Veröffentlichungen der
Abteilung Architektur des Kunsthistorischen Instituts der Universität Köln 9,
Köln 1975.
o
Finger, Heinz, Der gewaltsame Tod des
Kölner Erzbischofs Engelbert und die Vorgeschichte, in: Ritter, Burgen und
Intrigen. AufRuhr 1225! Das Mittelalter an Rhein und Ruhr, herausgegeben vom
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Mainz 2010, 21-33.
o
Heinrichs, Joseph, Geschichte des
bergischen Landes, seiner Burgen, Rittersitze, Abteien und geschichtlich
merkwürdigen Orte. Mit Hinweisen auf die brandenburgisch-preußische Geschichte
und auf mancherlei Gleichzeitiges für Schule und Haus erzählt, Köln 1890;
Wuppertal 1984.
o
Hoffmann, G., Altenberg. Vom
Zisterzienserkloster zur Jugendbildungsstätte, in: Jahrbuch der Rheinischen
Denkmalpflege 42 (2011), 40-71.
o
Hoffmann, G., N. Nußbaum u. S. Lepsky,
Neue Forschungen zur romanischen Klosteranlage in Altenberg, in: 1259.
Altenberg und die Baukultur im 13. Jahrhundert, herausgegeben von N. Nußbaum u.
S. Lepsky, Regensburg 2010.
o
Janke, Petra, Dat werde leven hiltom
[Das werte, liebe Heiltum/Heiligtum]. Zur Verehrung der Heiligen und ihrer
Reliquien am Altenberger Dom, Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der
Zisterzienser, Band 29, Berlin 2009.
o
Janssen, Wilhelm, Das Erzbistum Köln im
späten Mittelalter 1191-1515, Geschichte des Erzbistums Köln, 2. Band, Köln
1995.
o
Junggeburth, T., „So gehen wir in
seinem Licht…“. Haus Altenberg. Wo junge Menschen Zukunft bilden, Bergisch
Gladbach 2016.
o
Kaltenbach, Wilhelm, Der Lebensweg der
letzten Altenberger Mönche. Die Auflösung der Cistercienser-Abtei anno 1803,
in: Altenberger Blätter, Heft 93, Odenthal-Altenberg 2023, 57-61..
o
Lepsky, S., u. N. Nußbaum, Gotische
Konstruktion und Baupraxis an der Zisterzienserkirche Altenberg. 1. Die
Choranlage, Veröffentlichungen des Altenberger Dom-Vereins 9, Bergisch Gladbach
2005.
o
Lepsky, S., u. N. Nußbaum, Gotische
Konstruktion und Baupraxis an der Zisterzienserkirche Altenberg. 2. Quer- und
Langhaus, Veröffentlichungen des Altenberger Dom-Vereins 11, Bergisch Gladbach
2012.
o
Martin, Julia, Beispiel „Laudato si“.
Wie viel Ehre Missbrauchstätern noch schenken? (15. Mai 2023), in:
https://www.katholisch.de/artikel/45048-beispiel-laudato-si-wie-viel-ehre-missbrauchstaetern-noch-schenken
(abgerufen am 11. Februar 2024).
o
Mosler, Hans, Die Cistersienserabtei
Altenberg, Das Erzbistum Köln, Band 1, Germania Sacra, Neue Folge, Band 2,
Berlin und New York 1965; Berlin und New York 2013.
o
Orthen, Norbert, Die Darstellung der
Verkündigung des Herrn im Dom zu Altenberg, in: Altenberger Blätter, Heft 92,
Odenthal-Altenberg 2023, 33-41.
o
Peters, Wilhelm, Abglanz der
Herrlichkeit. Zisterziensertexte und Glasmalereien aus dem Westfenster des
Altenberger Domes, Einführung sowie Auswahl der Bilder und Texte von Falko
Bornschein, Berlin 2000.
o
Riquier, C., Der Kapitelsaal der
Zisterzienserabtei Altenberg, Veröffentlichungen des Altenberger Dom-Vereins 8,
Bergisch Gladbach 2003.
o
Schäfer, H.A., Bericht über die in den
Jahren 1908-1910 ausgeführten Wiederherstellungsarbeiten am Altenberger Dom,
in: Altenberger Dom-Verein, Jahresbericht für die Jahre 1908-1910, Düsseldorf
1911, 10-41.
o
Schmitz, Klaus Peter, Illustrierte
Pfarrgeschichte St. Marien Schwelm, Schwelm 2008, 26-29 (Erzbischof Engelberts
Tod in Schwelm).
o
Stirnberg, Reinhold, Auf den Spuren der
Grafen von Berg, Landschaft und Geschichte e. V., Odenthal 2017.
o
Uelsberg, G., L. Altringer, G. Mölich,
N. Nußbaum u. H. Wolter von dem Knesebeck, Die Zisterzienser. Das Europa der
Klöster, Bonn 2017 (146-153: S. Lepsky, Klausur Altenberg).
o
Untermann, M., H. Becker, M. Groten u.
G. Nobis, Die Grabungen auf der Burg Berge (Mons) – Altenberg, Gemeinde
Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Beiträge zur Archäologie des Mittelalters
III, Köln 1984.
© Dr. Heinrich Michael Knechten, Stockum 2025