Das vierzehnte Jahrhundert
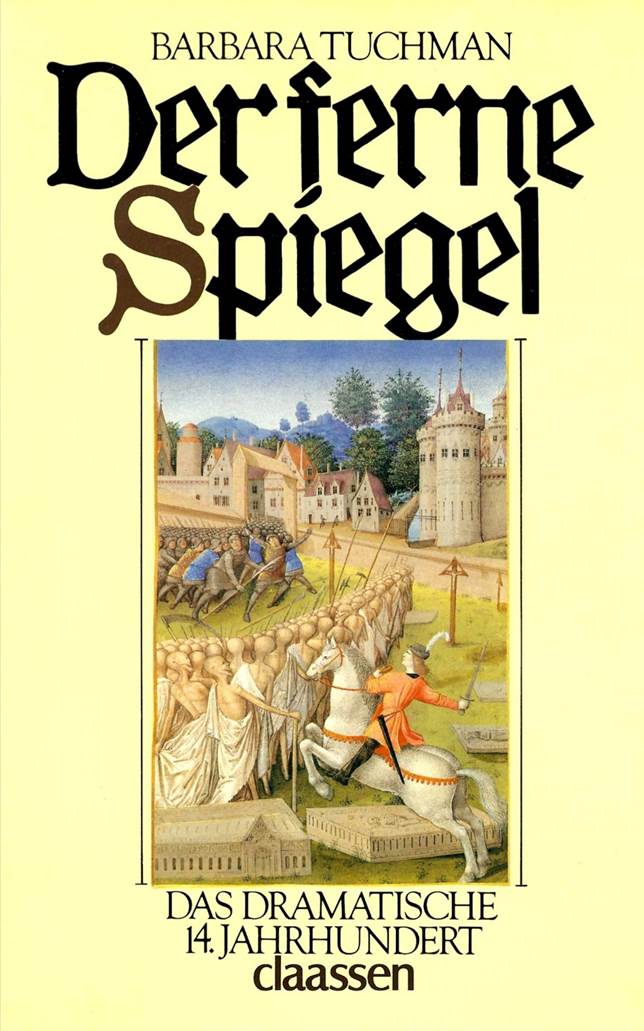
Barbara Tuchman, Distant Mirror. The Calamitous 14th Century, New York 1978; Der ferne Spiegel. Das dramatische 14. Jahrhundert, Übersetzung von Ulrich Leschak und Malte Friedrich, leicht gekürzte Ausgabe, Düsseldorf 1980
Der Schwarze Tod raffte zwischen 1348 und 1350 ein Drittel der zwischen Island und Indien lebenden Bevölkerung hinweg. Seuche, Krieg, Steuern, Räuberei, Mißwirtschaft, Aufruhr und Kirchenschisma, das der heutigen Zeit meist wenig bedeutet, aber damals die Grundfesten der Gesellschaft erschütterte – dies sind sieben apokalyptische Reiter statt der vier der Geheimen Offenbarung des Johannes (Offb 6, 1-8): Krieg, Hunger, Seuche und Gewalt.
Die Autorin
Barbara Wertheim (1912-1989) schloß ihr Studium am Radcliffe College in Cambridge, Massachusetts im Jahre 1933 mit der Arbeit „The Moral Justification of the British Empire“ ab und erhielt den Grad eines Bachelor of Arts.
1937 berichtete sie von Madrid aus als Auslandskorrespondentin über den Spanischen Bürgerkrieg. 1938 veröffentlichte sie: „The Lost British Policy“ über die Beziehungen zwischen Großbritannien und Spanien seit 1700. Im Jahre 1940 heiratete sie in New York den Internisten Lester Reginald Tuchman (1904-1997). Mit ihm hatte sie drei Töchter.
1956 erschien: „Bible and Sword. England and Palestine from the Bronze Age to Belfour“, welches die Entstehung und Hintergründe der Belfour Declaration im Jahre 1917 erklärt. „The Zimmerman Telegram“ (1957) über eine Depesche von Arthur Zimmermann, welche 1917 ein Bündnis zwischen dem Deutschen Reich und Mexiko anzielte. „The Guns of August“ (1962) behandelt den Beginn des Ersten Weltkrieges. 1972 erschien „Stilwell and the American Experience in China. 1911-1945“.
„The Distant Mirror“, in dessen Mittelpunkt die Geschichte des französischen Adligen Enguerrand VII. de Coucy (Ingelram von Coucy; (um 1339 - 1398) steht, war ein weltweiter Erfolg. Kurz vor ihrem Tod erschien „The First Salute“ über die erste Anerkennung der Vereinigten Staaten von Amerika durch den niederländischen Gouverneur Johannes de Graaff (1729-1813) am 16. November 1776.

Les très riches heures du Duc de Berry (Das Stundenbuch des Herzogs von Berry), folio 90v, Der Reiter des Todes, Museum Condé, Schloß Chantilly. Dieses Buch zählt zu den größten Meisterwerken der Buchmalerei. Es wurde von den Brüdern von Limburg, Paul, Johan und Herman (um 1385-1416), zwischen 1410 und 1416 für ihren Dienstherrn Johann von Berry (1340-1416) gemalt. Alle vier starben im gleichen Jahr an der Pest. Die Bilder geben einen lebendigen Eindruck von der Lebensweise und den Anschauungen dieser Zeit. Auf diesem Bild scheut der Schimmel eines Ritters in rotem Gewande vor einer Mauer aus Totenschädeln. Einzelne Kreuze weisen diesen Ort als Friedhof aus. Hinter der Mauer klagen viele Menschen, die dicht aneinandergedrängt stehen. Im Hintergrund eine Burg und einzelne Bürgerhäuser einer Stadt. Ein treffendes Bild für den Schwarzen Tod, der viel Leid über die Menschen des 14. Jahrhunderts brachte. Als Trost steht unter diesem Bild: „Dominus regit (reget) me et nihil mihi deerit“ (Ps 22, 1) – Der Herr wird mich leiten, und mir wird nichts fehlen.
Zitate
Wenn unser letztes Jahrzehnt oder die letzten beiden eine Zeit erlöschender Gewißheiten und ungewöhnlicher Unruhe war, dann ist es beruhigend zu wissen, daß die Menschheit schon Schlimmeres durchlebt hat. (Barbara Tuchman, Der ferne Spiegel, Düsseldorf 1980, 9).
Nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs entstand die mittelalterliche Gesellschaft als ein Komplex einander widerstreitender Teile, der keiner effektiven weltlichen Zentralmacht unterworfen war. Als organisatorisches Prinzip bot sich nur die Kirche an, und dies war der Grund ihres Erfolgs, denn die Gesellschaft kann die Anarchie nicht ertragen. (Spiegel, 21).
Diese Privatkriege wurden von den Rittern mit wilder Kampfeslust geführt, sie kannten nur eine einzige Strategie: den Feind dadurch zu bezwingen, daß man so viele Untertanen wie möglich entweder tötete oder verstümmelte, die Ernte vernichtete und Weinberge, Werkzeuge, Scheunen und anderen Besitz zerstörte, um die Einkünfte aus dem Lande zu reduzieren. Aus diesem Grunde war die Bauernschaft das Hauptopfer der kriegführenden Parteien. (Spiegel, 23f).
Eine Person unter dem Bann war von den Sakramenten ausgeschlossen und zur Hölle verdammt, bis sie ihre Taten bereute und von ihnen losgesprochen wurde. In schwerwiegenden Fällen konnte nur der Bischof und in einigen Fällen sogar nur der Papst den Bann aufheben. Während er in Kraft war, mußte der örtliche Priester den Fluch zwei- oder dreimal jährlich vor der Gemeinde im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, aller Apostel und im Namen aller Heiligen aussprechen; dabei sollte die Totenglocke ertönen, die Kerzen mußten gelöscht werden, Kreuz und Meßbuch auf dem Boden liegen. Eigentlich sollte der Schuldige von allen sozialen Beziehungen isoliert werden, aber die Unannehmlichkeiten für alle Beteiligten waren so groß, daß sich die Nachbarn entweder darauf verlegten, sein Haus mit Steinen zu bewerfen , um ihn zur Reue zu bewegen, oder den Bann zu ignorieren. (Spiegel, 26).
Die Coucys hielten in ihrem Stolz hof wie große Fürsten. Sie hielten Gericht nach Art des Königs und unterhielten ihr Haus mit denselben Bediensteten wie der König: ein Waffenmeister, ein Hofmarschall, ein Jagdaufseher und Falkner, ein Stallmeister, ein Förster, ein Küchenchef oder Oberkoch, ein Bäckermeister, ein Meister der Vorratskeller, der Fruchtlagerung (einschließlich Gewürzen, Fackeln und Kerzen für die Beleuchtung) und ein Meister des Mobiliars (außerdem verantwortlich für die Teppiche und das Hoflager auf Reisen). Ein Feudalherr dieses Ranges beschäftigte gewöhnlich auch noch einen Arzt oder mehrere Ärzte, Friseure, Priester, Maler, Musiker, Sänger, Sekretäre und Schreiber, einen Astrologen, einen Hofnarren und einen Zwerg, daneben Pagen und Edelleute. Ein verdienter Lehnsmann arbeitete als Haushofmeister, als Châtelein oder Garde de Château, er leitete das gesamte Anwesen. Fünfzig Ritter, ihre Knappen, Begleiter und Diener, bildeten in Coucy zusammen eine ständige Besatzung von fünfhundert Leuten.
Äußere Pracht war als Statuszeichen unentbehrlich, und das bedeutete eine große Gefolgschaft in der Livree des Fürsten, aufwendige Feste, Tourniere, Jagden, Lustbarkeiten und vor allem großzügige Geschenke und eine verschwenderische Hofhaltung, die, weil das Gefolge davon lebte, als die meistbewunderten Attribute eines Adligen galten. […]
Da sie Gott am nächsten standen, rangierten die Geistlichen auf der obersten Stufe. Sie waren in zwei Hierarchien geteilt, die klösterliche und die weltliche, was für die letzteren bedeutete, daß sie ihre Aufgaben unter den Laien wahrzunehmen hatten. An der Spitze beider Hierarchien standen die Prälaten – Äbte. Bischöfe und Erzbischöfe, das geistliche Gegenstück zu den weltlichen Fürsten. Ein Prälat und ein armer, ungebildeter Priester, der von Almosen lebte, hatten nur wenig gemeinsam. (Spiegel, 29f).
Der Pferderücken war der Platz des Ritters, ein erhöhter Sitz, der ihn über die übrigen Menschen stellte. In jeder Sprache außer der englischen („knight“) bedeutet das Wort Ritter einen Mann auf dem Pferderücken. (Spiegel, 31).
Aus seinem Grundbesitz und seiner Zinsherrschaft leitete der Adlige sein Recht ab, über alle Gemeinen seines Gebiets mit Ausnahme der Geistlichkeit und der Kaufleute freier Städte zu herrschen. (Spiegel, 32).
Paris war ein Magnet für große Köpfe. Thomas von Aquin lehrte dort im 13. Jahrhundert wie auch sein deutscher Lehrer Albertus Magnus und sein philosophischer Gegner Duns Scotus aus Schottland. Im nächsten Jahrhundert trafen sich dort die großen politischen Denker Marsilius von Padua und der Engländer Wilhelm von Ockham. Paris war wegen seiner Universität das „Athen Europas“, in dem sich, so sagte man, die Göttin der Weisheit niederließ, nachdem sie Griechenland und Rom verlassen hatte. (Spiegel, 34).
Das jährliche Einkommen eines Besitzes von der Größe Coucys muß in der Nähe von 5000 oder 6000 Pfund gelegen haben. Steuern, Pachtzinsen und andere feudale Verpflichtungen, die mehr und mehr mit Geld beglichen wurden, Brückenzölle und Gebühren für die Benutzung der Mühlen, Weinpressen, Backöfen und anderer Einrichtungen des Landesherrn trugen dazu bei. (Spiegel, 35).
Die einfachen Kirchenleute eiferten den Kirchenfürsten nach. Wenn die Prälaten in reicher Kleidung einherkamen, verloren auch die kleineren Würdenträger die Lust an ihren dunklen Röcken. Die Beschwerden häuften sich, wie die des Erzbischofs von Canterbury im Jahre 1342, der beklagte, daß sich die Geistlichkeit wie Laien kleidete mit rot und grün karierten Mänteln, „eng anliegend“ und mit besonders weiten Ärmeln, die Pelz- und Seidenbesätze aufwiesen, mit Hüten und Stolas von „erstaunlicher Länge“, mit spitzen und geflochtenen Schuhen und juwelenbesetzten Gürteln mit goldenen Taschen. (Spiegel, 42).
Beim alljährlichen Fest der Narren, das um die Weihnachtszeit stattfand, gab es keinen Ritus und kein Gebot, die nicht Gegenstand von Witzen geworden wären, egal, wie heilig sie waren. Ein Dominus Festi [Herr des Festes] oder König der Narren wurde von der niederen Geistlichkeit gewählt und gekrönt, von den Pfarrern, den Subdechanten, den Vikaren und Kirchenmeistern. Alle waren sie ungebildet, unterbezahlt und undiszipliniert. An ihrem Festtag aber kehrten sie das Oberste zuunterst. Sie weihten ihren König zum Papst, Bischof oder Abt der Narren. Sie schoren ihm unter obszönen Reden den Kopf und machten anzügliche Gesten. Sie kleideten ihn mit Gewändern, deren Innenseiten nach außen gekehrt waren, spielten Würfel auf dem Altar, aßen schwarze Puddings und Würste, während eine Messe zelebriert wurde, die nur aus unsinnigem Gestammel bestand. Dazu schwangen sie Weihrauchfässer aus alten Schuhen, denen ein „schrecklicher Gestank“ entwich. Während sie die Zeremonien des Gottesdienstes höhnend imitierten, trugen sie Tiermasken oder waren als Frauen oder Sänger verkleidet, sie sangen obszöne Lieder im Chor, sie heulten und schrien, während der „Papst“ eine verballhornte Segensformel vorlas. Auf seine Aufforderung, ihm zu folgen, zogen sie ungestüm in die Stadt. Sie führten ihren „König“ in einer Karre mit sich, von wo aus er scherzhafte Bußen in die Menge schrie. Sein Gefolge zischte, gackerte und gestikulierte dazu. Sie brachten die Anwesenden mit „ungebührlichen Vorführungen“ zum Lachen und ließen Büttenredner mit seltsamen Predigten auftreten. Nackte Männer zogen Mistkarren und warfen deren Inhalt unter die Umstehenden. Saufereien und Tänze begleiteten die Prozession. (Spiegel, 44f).
Nicht Gerechtigkeit erwartete man von der Kirche, sondern Vergebung. Aber die Kirche tröstete nicht nur, sie gab auch Antworten. Seit fast tausend Jahren schon war die Kirche die Institution, die dem Leben in einer widersprüchlichen Welt Sinn und Bedeutung gab. Sie bestätigte, daß das irdische Leben des Menschen nichts anderes als eine Exilstation auf dem Wege zur ewigen Seligkeit war, zum neuen Jerusalem, zu unserer „anderen Heimat“ [Phil 3, 20]. Das Leben war nichts anderes, schrieb Petraca an seinen Bruder, als „eine schwere und entbehrungsreiche Reise zu der ewigen Heimat, die wir suchen, oder sollten wir die Erlösung verfehlen, eine ebenso freudlose Reise in den ewigen Tod“. Die Kirche versprach Erlösung, die nur durch ihre Rituale erreicht werden konnte, nur durch den Beistand und die Hilfe der geweihten Priester. „Extra ecclesiam nulla salus.“ Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, das war die Losung.
Die Alternative zur Erlösung war Hölle und ewige Qual, wie sie sehr realistisch von der Kunst der Zeit dargestellt wurde. In der Hölle hingen die Verdammten mit ihrer Zunge an Feuerbäumen, die Unbußfertigen schmorten in Feueröfen, und die Ungläubigen erstickten in stinkendem Rauch. Die Bösen fielen in das schwarze Wasser eines Abgrunds bis zu einer Tiefe, die ihren Sünden entsprach, die Unzüchtigen bis zu den Nasenlöchern, die Grausamen bis an die Augenbrauen. Einige wurden von monströsen Fischen verschlungen, andere von Dämonen zerfressen, wieder andere von Schlangen gequält, von Feuer, Eis, oder vom Anblick von Früchten, die außerhalb der Reichweite der Dürstenden hingen. Die Menschen in der Hölle waren nackt, namenlos und vergessen. Kein Wunder, daß alle Welt auf Erlösung hoffte und der Tag des Gerichts in aller Köpfen gegenwärtig war. Über den Türen der Kathedralen war zur eindringlichen Erinnerung dargestellt, wie die zahlreichen Sünder von den Teufeln gefesselt, zu flammenden Kesseln geführt wurden und wie die wenigen Auserwählten von Engeln in die entgegengesetzte Richtung geleitet wurden. (Spiegel, 46).
Marsilius von Padua hatte 1324 die Souveränität des Staates in seinem Buch Defensor pacis [Verteidiger des Friedens] behauptet. Der Papst versuchte dem mit Exkommunikation zu begegnen. Nach Marsilius verwies Johannes XXII. den englischen Franziskaner Wilhelm von Ockham, der wegen seiner Argumentationskraft der „unbesiegbare Doktor“ genannt wurde, aus der Kirche. Unter dem Begriff des „Nominalismus“ hatte Ockham eine Philosophie entwickelt, die die Tür zu einer intuitiven Erkenntnis der wirklichen Welt aufstieß. In gewissem Sinne war er ein Anwalt geistiger Freiheit, und der Papst erkannte die Gefahren, die darin für die Kirche lagen, und exkommunizierte ihn. Als Erwiderung darauf klagte Ockham den Papst in einer Streitschrift als Urheber von siebzig Irrtümern und sieben Ketzereien an. (Spiegel, 48).
Zum großen Unglück dieses Jahrhunderts trug kein einzelner Faktor mehr bei als als das beständige Mißverhältnis zwischen dem Anwachsen des Staates und den Mitteln zu seiner Finanzierung. Auf der einen Seite entwickelte sich ein zentralistisches Regierungssystem, aber auf der anderen Seite basierte die Besteuerung immer noch auf dem Konzept, daß Steuern eine Notstandsmaßnahme waren, die überdies der Zustimmung der Betroffenen bedurfte. (Spiegel, 50).
Jeanne [1311-1349], die vierjährige Tochter des ältesten Bruders, wurde zugunsten ihres Onkels übergangen, der als König Philipp V. [1293-1322; König ab 1316] gekrönt wurde. Danach rief er eine Versammlung aus Honoratioren der drei Stände und der Universität von Paris zusammen, die sein Recht auf die Krone bestätigten und festlegten, daß „keine Frau den Thron von Frankreich besteigen“ dürfe. Damit war das folgenschwere Salische „Gesetz“ geboren, das der weiblichen Thronfolge einen Riegel vorschob, den es bis dahin gegeben hatte. (Spiegel, 52).
Zu Beginn schien der Krieg keine ernsthafte Kraftprobe zwischen England und Frankreich zu werden, da Frankreich die führende Macht in Europa war, deren militärischer Ruhm in seinen eigenen Augen und auch nach Ansicht anderer Länder den Englands bei weitem übertraf. Außerdem war Frankreich mit seinen 21 Millionen Menschen fünfmal so bevölkerungsstark wie England mit seinen wenig mehr als vier Millionen Menschen. Dennoch, der Besitz von Aquitanien und das Bündnis mit Flandern gaben Eduard [III.; 1312-1377] zwei Brückenköpfe an den Grenzen Frankreich, die seiner dreisten Herausforderung an „Philipp von Valois [Philipp VI.; 1293-1350], der sich König von Frankreich nennt“, mehr als nur verbalen Nachdruck verliehen. Keiner der beiden Gegner konnte wissen, daß sie in einen Krieg zogen, der sie beide überleben sollte, der ein Eigenleben entwickeln würde, der Verhandlungen, Waffenstillständen und Verträgen trotzen und sich noch in das Leben ihrer Söhne schleppen sollte, in das Leben ihrer Enkel und Großenkel, ja bis in das der Nachkommen der fünften Generation, ein Konflikt der beide Seiten an den Rand der Zerstörung bringen und sich auf ganz Europa ausdehnen sollte: der Hundertjährige Krieg [1337-1453], die letzte große Plage des ausgehenden Mittelalters. (Spiegel, 55).
Von allen Eigenheiten, in denen sich das Mittelalter von der heutigen Zeit unterscheidet, ist keine so auffallend wie das fehlende Interesse an Kindern. (Spiegel, 56).
Vielleicht hat es an der hohen Kindersterblichkeit gelegen (eins oder zwei von drei Kindern starb), daß die Liebesmühen um ein Kind so wenig lohnend erschienen. Vielleicht haben aber auch die häufigen Schwangerschaften zu der Interesselosigkeit beigetragen. Ein Kind starb, ein neues wurde geboren und nahm seinen Platz ein. (Spiegel, 57).
Vielleicht erklärt die emotionale Kahlheit einer mittelalterlichen Kindheit die Gefühllosigkeit des mittelalterlichen Menschen dem Leben und dem Leiden anderer gegenüber. (Spiegel, 58f).
Das Kindische, das im Verhalten des mittelalterlichen Menschen in seiner Impulsivität, seiner mangelnden Selbstkontrolle so deutlich war, mag einfach dadurch zu erklären sein, daß ein so großer Teil der mittelalterlichen Gesellschaft wirklich sehr jung war. Man nimmt an, daß etwa die Hälfte der Bevölkerung unter einundzwanzig war und vielleicht ein Drittel unter vierzehn. (Spiegel, 59).
Einem Herrn zu dienen, wurde nicht als erniedrigend angesehen. Es war völlig normal, daß ein Page oder ein erwachsener Knappe dem Herrn beim Baden half, für seine Kleider sorgte, ihn bei Tisch bediente und dennoch dessen adligen Status teilte. Als Gegenleistung für diese unbezahlte Arbeit kümmerte sich der Herr um die Ausbildung der Adelskinder. Sie lernten zu reiten, zu kämpfen und zu jagen, was die drei Hauptbeschäftigungen adligen Lebens waren. Sie lernten auch Schach und Backgammon spielen, zu singen, zu tanzen, zu musizieren, zu komponieren und andere romantische Fertigkeiten. Der Burgkaplan oder ein benachbarter Abt kümmerten sich um die religiöse Erziehung der Knaben, die sie auch im Lesen und Schreiben weiterbildeten und denen sie möglicherweise darüber hinaus auch noch einen Teil der Grundschulausbildung zukommen ließen, die die nichtadligen Kinder absolvierten. Mit vierzehn oder fünfzehn, wenn sie zum Knappen ernannt wurden, intensivierte sich die Kampfschulung der Adelssöhne. Sie lernten, die schwingende Strohpuppe, die als Zielscheibe diente, mit der Lanze aufzuspießen, das Schwert zu handhaben und eine Menge anderer tödlicher Waffen zu beherrschen; sie lernten die ritterliche Heraldik kennen und die Gesetze des Zweikampfs. Als Knappe führten sie das Schlachtroß ihres Herrn und hielten es, wenn dieser zu Fuß kämpfte. Sie halfen dem Seneschall [Seniorschalk = Altknecht, Oberhofbeamter] bei seiner Arbeit, verwahrten die Schlüssel, führten vertrauliche Kurierdienste aus und beaufsichtigten das Geld und andere Wertgegenstände auf Reisen. Für Buchwissen blieb in diesem Programm wenig Zeit, obwohl ein junger Adliger je nach Neigung Bekanntschaft mit ein wenig Geometrie, Jurisprudenz, Rhetorik und in einigen Fällen auch Latein machen konnte.
Frauen von adligem Stand genossen gewöhnlich eine bessere Schulbildung als die Männer, denn obwohl die Mädchen nicht wie die Knaben im Alter von sieben Jahren das elterliche Haus verließen, wurde ihre Unterrichtung von der Kirche ermutigt, damit sie in Glaubensdingen vorbereitet waren, falls die Eltern sie – mit angemessener Mitgift – in ein Nonnenkloster schickten. Neben dem Lesen und Schreiben des Französischen und Lateinischen wurden sie in der Kunst des Musizierens, in der Astronomie und in den Grundbegriffen der Medizin und der Ersten Hilfe unterwiesen. (Spiegel, 59f).
Der Letzte der Coucys erblickte das Licht der Welt, in der die Bewegung noch durch die Geschwindigkeit von Mensch oder Pferd bestimmt war, in der Nachrichten und öffentliche Verlautbarungen durch die menschliche Stimme verbreitet wurden und in der für die meisten Menschen das Licht des Tages mit der untergehenden Sonne endete. Mit der Abenddämmerung wurden Hörner geblasen oder Glocken geläutet, die den Zapfenstreich oder das „Feuer aus!“ verkündeten. Danach war die Weiterarbeit verboten, da die Handwerker bei dem schlechten Licht nicht mehr zuverlässig arbeiten konnten. Die Reichen konnten den Tag durch Fackeln oder Kerzen verlängern, aber für die anderen war die Nacht so dunkel, wie die Natur sie machte, und Stille umgab einen Reisenden bei Nacht. (Spiegel, 60). [Der „Zapfenstreich“ hat seine Bezeichnung vom Schlag (Streich) auf den Zapfen, mit dem das Weinfaß verschlossen und der Ausschank beendet wurde.]
Der mittelalterliche Mensch fühlte sich von Rätseln umgeben, aber da es Gott gab, war er bereit anzuerkennen, daß der Mensch nicht alles über die Natur der Dinge wissen konnte, „sie sind so, wie es Gott gefällt“.
Das aber brachte die eine, unaufhörliche Frage nicht zum Schweigen: Warum erlaubt Gott das Böse, die Krankheit und die Armut? Warum hat Er den Menschen nicht zur Sünde unfähig gemacht? Warum hat Er dem Menschen nicht das Paradies gelassen? Die nie vollständig zufriedenstellende Antwort hieß, daß Gott dem Teufel seine Macht schuldete. Nach der Lehre des heiligen Augustinus, der Quelle aller Autorität, waren alle Menschen durch die Erbsünde dem Teufel ausgeliefert; daher die Notwendigkeit der Kirche und der Erlösung. (Spiegel, 66).
Die Erziehung, die Enguerrand VII. de Coucy möglicherweise zuteil wurde, basierte auf den „sieben freien Künsten“: Grammatik, die Grundlage aller Wissenschaften; Logik, die das Wahre vom Falschen unterscheidet; Rhetorik, die Quelle des Rechts; Arithmetik, die Grundlage der Ordnung, denn „ohne Zahlen gäbe es nichts“; Geometrie, die Wissenschaft der Vermessung; Astronomie, die edelste der Wissenschaften, weil sie mit Religion und Theologie in Verbindung stand; schließlich die Musik. Die Medizin, obwohl keine der freien Künste, war der Musik analog, weil beide sich mit der Harmonie des menschlichen Körpers beschäftigten.
Die Geschichte war begrenzt und spielte sich in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum ab. Sie begann mit der Schöpfung und würde in einer absehbaren Zukunft mit der Wiederkehr Christi enden, in der die Hoffnung der gequälten Menschheit lag. Während dieser Zeitspanne gab es für die Menschheit weder sozialen noch moralischen Fortschritt, , da sein Ziel das Jenseits war, nicht die Verbesserung des Diesseits. (Spiegel, 66f).
Da aufgrund der Steuerfreiheit für Adel und Kirche der dritte Stand den größten Teil der Steuern zahlte, hatte er auch die Entscheidungsgewalt über die Höhe der Abgaben. Die Bürgerlichen nutzten diesen Umstand als Hebel zur Durchsetzung von Reformen und Privilegien, was die Monarchie bei jedem dieser Hilfsersuchen in eine schwierige Lage brachte. (Spiegel, 139).
[König Johann II. der Gute (1319-1364) wurde im Jahre 1356 in Poitiers von den Engländern gefangengenommen und nach London gebracht. Dort wurde ein Lösegeld von drei Millionen Goldstücken und mehreren Provinzen, die an die Engländer abzutreten waren, gefordert.]
In jener dunklen Stunde Frankreichs finden sich in Johanns Buchführung Ausgaben für Pferde, Hunde, Jagdfalken, ein Schachspiel, eine Orgel, eine Harfe, eine Uhr, ein rehbraunes Reitpferd, Wildbret und Walfleisch aus Brügge, teure Kleidung für seinen Sohn Philipp und seinen Lieblingsnarren, der verschiedene hermelinbesetzte und goldgeschmückte Hüte erhielt. Johann unterhielt einen Astrologen, einen „Sängerkönig“ samt Orchester, inszenierte Hahnenkämpfe, ließ Bücher kostbar binden und verkaufte Wein und Pferde, die er von der Languedoc [Hauptstadt: Toulouse] als Geschenk erhalten hatte. (Spiegel, 163).
Die Menschen dieser Zeit waren für das gesprochene Wort außerordentlich empfänglich, und jeder Marc Anton [† 30 vor Christus; Feldherr und Redner, bekannt sind die Philippischen Reden] konnte die leichte Erregbarkeit der Zuhörer ausnutzen. Man hörte damals stundenlang im Freien die Predigten großer Kirchenmänner an und betrachtete sie als eine Art populärer Unterhaltung. (Spiegel, 164).
Schwer trug der Bauer an der Verachtung, mit der ihm die anderen Klassen begegneten. Auch die Erzählungen und Balladen der Zeit beschreiben ihn fast ausnahmslos als aggressiv, unverschämt, gierig, mürrisch, mißtrauisch, häßlich, dumm und immer unzufrieden. (Spiegel, 168).
Die einfachen Leute „stöhnten“, schrieb Jean de Venette [Jean Fillon, 1307 bis nach 1368], „wenn sie sahen, wie die Gelder, die sie mühsam zu Kriegszwecken aufgebracht hatten, in Unterhaltung und Luxus verschwendet wurden.“ (Spiegel, 169).
König Eduard selbst sprach wahrscheinlich nicht fließend Englisch. Französisch war die Unterrichtssprache in den Schulen [Englands]. (Spiegel, 185f).
Drei Viertel von Frankreich waren ihr Jagdgrund, vor allem Burgund, die Normandie, die Champagne und Languedoc. Befestigte Städte konnten Widerstand leisten, aber das Land war den Briganten ausgeliefert und wurde immer wieder verwüstet. Eine Vagabundenbevölkerung entstand aus verarmten Bauern, arbeitslosen Handwerkern und Priestern ohne Gemeinden. (Spiegel, 210).
Die Jagdmäntel der Damen waren mit Glocken besetzt, und Glocken hingen auch an vielen Gürteln, die ein wichtiger Teil der Kleidung waren, da sie eine Menge Ausrüstung zu tragen hatten: den Geldbeutel, die Schlüssel, das Gebetbuch, den Rosenkranz, eine Reliquie, Handschuhe, die Parfümdose, eine Schere und Nähzeug. (Spiegel, 219).
Umwölkt von der Metaphysik der Transsubstantiation, wurde das Abendmahl in seiner Bedeutung von den Laien kaum erfaßt, man glaubte einfach an die magische Kraft der heiligen Oblate. Wenn man sie auf die Kohlköpfe im Garten legte, sollte sie schädliche Insekten abwehren, und in einen Bienenkorb gelegt, um den Schwarm zu beruhigen, soll sie einmal fromme Bienen dazu gebracht haben, eine ganze Kathedrale aus Wachs mit Bögen, Fenstern, Glockenturm und Altar zu bauen, auf den die Bienen dann die heilige Oblate legten. (Spiegel, 220).
Er [König Eduard] ließ mit den üblichen Maßnahmen der Beschlagnahmung von Kauffahrteischiffen samt Kapitänen und Mannschaften eine Flotte zusammenstellen, nahm den kranken Schwarzen Prinzen und Johann von Gent mit sich und segelte mit einer großen Streitmacht Ende 1372 los. Aber er wurde vom Wetter besiegt – ungünstige Winde, die neun Wochen lang anhielten, warfen die Flotte immer wieder zurück oder zwangen sie in Häfen, so daß es schließlich zu spät wurde, noch vor dem Winter die Überfahrt [nach Frankreich] zu riskieren. Auf Kosten enormer Ausgaben für Lebensmittel und Ausrüstung, für Sold und Unterhalt, war der König gezwungen, das Unternehmen aufzugeben.
Die Technologie des Mittelalters schuf Wunder an Architektur, sie erfand die Mechanik des Webstuhls und eine Getriebewelle, die die Kraft des Windes in die Drehung eines schweren Mühlsteines umsetzte, aber sie schaffte es nicht, das Vorsegel, das Besansegel [in Längsschiffsrichtung] und den seitlich beweglichen Großbaum zu entwickeln, der es erlaubt hätte, die Segel der Windrichtung anzupassen. Durch solche Zufälle des menschlichen Geistes werden Krieg, Handel und Geschichte geformt. (Spiegel, 246f).
Die Korruptheit, wenn auch nicht die Lüsternheit, des Gemeindepriesters war gewöhnlich eine Folge der Tatsache, daß er unterbezahlt war, was ihn zwang, die kirchlichen Diensthandlungen zu verkaufen; selbst das Abendmahl konnte dem Kommunikanten vorenthalten werden, wenn er keine Spende anbot – ein Hohn auf das Ritual. Frivolität und Weltlichkeit wurde den Priestern in einem kirchlichen Ermahnungsschreiben von 1367 vorgeworfen; darin hieß es, sie trügen kurze, enge Wämser, mit langen pelz- oder seidengefütterten Ärmeln, kostbare Ringe und Gürtel, bestickte Börsen, Messer, die Schwertern ähnelten, farbige Stiefel und sogar jenes Teufelswerk, die langen, gekrümmten, spitzen Schuhe.
Als Wyclif [* spätestens 1330 und † 1384] solche unheiligen Priester schmähte und nachzuweisen suchte, daß das Priestertum zur Erlösung nicht wesentlich war, zielte dieser Schlag gegen die Grundlagen der Kirche und ihre Deutung der Rolle Christi. Er steuerte unerbittlich auf die Leugnung der Transsubstantiation zu, denn ohne transzendente Macht konnte es dem Priester nicht möglich sein, Brot und Wein in den wahren Leib und das wahre Blut Christi zu verwandeln. Von da aus gesehen, folgte der Rest logisch: die Nichtnotwendigkeit des Papstes, die Ablehnung der Exkommunikation, der Beichte, der Pilgerfahrten, der Verehrung der Reliquien und der Heiligen, der Ablässe und käuflichen Absolutionen. All dies sollte von Wyclifs Besen beiseite gefegt werden. Als Ersatz bot er die Bibel in englischer Sprache an. (Spiegel, 265).
Wyclifs Ideen und die Bedürfnisse der Krone paßten zusammen wie Schwert und Scheide. Das erklärt die seltsame Allianz, die ihn zum Protegé Johanns von Gent [1340-1399] machte. Seine Theorie der Enteignung, die postulierte, daß Adlige Ländereien zurückfordern dürften, die ihre Vorfahren der Kirche hinterlassen hatten, gaben Johanns Absicht, das reiche geistliche Establishment auszuplündern, theologische Substanz. Denn was Heinrich VIII. anderthalb Jahrhunderte später erfolgreich abschloß, plante Johann von Gent schon 1376. (Spiegel, 266).
Was zählt, sind weniger die Tatsachen, als das, was die Öffentlichkeit für Tatsachen hält. (Spiegel, 267).
Der Ritter lebte vom Raub am Kaufmann; jede Stadt glaubte, ihre Wohlhabenheit hinge vom Ruin ihrer Rivalin ab; innerhalb der Städte kämpften Kaufleute und Handwerkszünfte um die Macht; eine ausgebeutete Bauernschaft lebte in schwelendem Zorn, der periodisch in die Flammen des Aufstands umschlug. Das Kaiserreich hatte keinen politischen Zusammenhalt, keine gemeinsamen Gesetze, keine Hauptstadt, keine gemeinsamen Finanzen und keine gemeinsamen Beamten. Es war der Überrest einer toten Idee. (Spiegel, 279f).
Die Staatsessen zogen alle Register des 14. Jahrhunderts, um die Gäste zu entzücken, zu erstaunen und vollzustopfen. Es standen so viele Fackelträger zwischen den Säulen des Saals, „daß man so gut sehen konnte wie im Tageslicht.“ So viele Gänge und Gerichte wurden aufgetragen, daß sie dieses eine Mal „nicht gezählt werden konnten“, zu viele auf jeden Fall für den kränkelnden Ehrengast [Kaiser Karl IV.]. Der [französische] König [Karl V.] hatte bereits auf einen von jeweils zehn Gängen verzichtet, um die Zeit, die der Kaiser an der Tafel sitzen mußte, zu verkürzen, aber dennoch mußte der Gast von etwa dreißig Gerichten kosten, darunter geröstete Kapaune, Rebhühner, Hasenzibet [okzitanisch cive – Schnittlauch, hier für Frühlingszwiebeln], Fleisch- und Fischaspik, Lerchenpastete, Rissoles [Halbmondpasteten] aus Rindermark, schwarzer Pudding [Serviettenkloß mit Rindernierenfett, Nüssen und Brandy] und Würste, gewürzter Reis, Zwischengerichte von Schwan, Pfau, Rohrdommel und Reiher, Wildpasteten und Singvögel, Süß- und Salzwasserfisch mit Süßwasserheringssauce „in der Farbe von Pfirsichblüten“, weißer Lauch mit gebratenem Regenpfeifer, Ente mit Schweineinnereien, gefülltes Ferkel, Aal, geschmorte Bohnen – und als Nachspeise Fruchtwaffeln, Birnen, Konfekt, Mispelfrucht, Nüsse und gewürzter Wein. (Spiegel, 281f).
Sex und Sadismus wurden in der Vergewaltigung Dinas [Gen 34, 2] ausgespielt, in der Darstellung des nackten, betrunkenen Noahs [Gen 9, 21], der Sünden der Sodomiter [Gen 13, 13] und den vielen Spielarten blutigen Martyrertodes. Folterszenen in krassem Realismus waren feste theatralische Elemente, als hätte eine gewalttätige Zeit den Genuß der Gewalt hervorgebracht. [Die Szene mit] Nero, der seiner Mutter den Bauch aufschlitzte, um nachzusehen, woher er gekommen war, wurde mit der Hilfe tierischer Eingeweide in blutrünstigem Detail ausgespielt. (Spiegel, 283).
Seit Juni 1376 hielt sich Katharina von Siena in Avignon auf und ermahnte den Papst unablässig, als Zeichen für die Reform der Kirche nach Rom zurückzukehren. (Spiegel, 292).
Als er die Enteignung der Kirche gepredigt hatte, war Wyclif von mächtigen Freunden gedeckt worden, aber als er die Hierarchie selbst und das Priestertum angriff, zogen sich seine Beschützer, die den Vorwurf der Ketzerei fürchteten, zurück. 1381 erklärte eine Synode von zwölf Doktoren der Universität Oxford acht seiner Thesen für unorthodox sowie vierzehn für ketzerisch und verbot ihm Vorlesungen und Predigten. Obwohl Wyclif selbst damit zum Schweigen verurteilt war, verbreitete sich sein Denken mit dem Erscheinen der Bibel auf Englisch [im Jahre 1383. Dies ist eine Zusammenfassung früherer Übersetzungen]. Die gesamte Heilige Schrift wurde von Wyclif und seinen Jüngern aus dem Lateinischen übersetzt – es war der große und gefährliche Versuch, den Menschen einen direkten Weg zu Gott zu öffnen, ohne den Umweg über den Priester. In der bevorstehenden Zeit der grimmigen Reaktion auf den Bauernaufstand, als die Lollharden [vom mittelniederländischen lollen – Gebete murmeln], zu denen Wyclifs Jünger zählten, verfolgt wurden und der bloße Besitz einer englischen Bibel jemanden der Ketzerei überführen konnte, war die Herstellung und vielfältige Abschrift des Bibelmanuskripts eine riskante und mutige Arbeit. (Spiegel, 304).
Das Königreich von Neapel blühte kulturell und wirtschaftlich unter der zivilisierten Herrschaft König Roberts [I. von Anjou; 1278-1343] auf, des „neuen Salomons“, dessen literarisches Urteil selbst Petrarca suchte. Boccaccio folgte Petrarca nach Neapel, weil er das Leben in dem „glücklichen, friedvollen, großzügigen und prächtigen Neapel mit seinem einzigartigen Monarchen“ dem Aufenthalt in dem „von unzähligen Sorgen zerfressenen“ Florenz, seinem Heimatstaat, vorzog. Robert baute seinen Palast Castel Nuovo an der unvergleichlichen Bucht von Neapel, wohin die Schiffe von Genua, Spanien und der Provence kamen, um Handel zu treiben. Edelmänner und Kaufleute errichteten ihre palazzi in der Nachbarschaft und holten die Künstler der Toskana nach Neapel, um ihre Säle mit Skulpturen und Fresken zu schmücken. Unter gerechten Gesetzen und mit einer festen Währung, sicheren Straßen, Gasthäusern für reisende Händler, Festen, Turnieren und Musikveranstaltungen verwandelte sich das Land unter Roberts Herrschaft, die 1343 zu Ende ging, in „so etwas wie ein Paradies“. (Spiegel, 355).
Wenn diese sechzig Jahre [Cucy, um 1339-1398] einigen wenigen an der Spitze der Gesellschaft voller Glanz und Abenteuern erschienen, so waren sie für die meisten eine Folge unberechenbarer Gefahren: der drei galoppierenden Übel: Plünderung, Pest und Steuer; erbarmungsloser und tragischer Konflikte, bizarrer Schicksale, Hexerei und Betrug, Aufstand, Mord, Wahnsinn, Sturz einiger Fürsten; zurückgehender Feldarbeit, gerodeten Landes, das wieder zur Wildnis wurde; immer wiederkehrender Schatten der Pestilenz, , die ihre Botschaft von Sünde und Schuld sowie der Feindschaft Gottes unter die Menschen trug.
Die Menschheit wurde durch diese Botschaft nicht besser. Die Gewalttätigkeit warf alle Zügel ab. Es war eine Zeit der Verantwortungslosigkeit. Verhaltensregeln wurden kraftlos, Institutionen verfielen, die Ritterschaft schützte das Volk nicht; die Kirche, weltlich geworden, führte nicht mehr zu Gott; die Städte, einst Träger des Fortschritts, waren in gegenseitige Fehden verwickelt und im Inneren in Klassenkämpfen zerrissen; die Bevölkerung, reduziert durch den Schwarzen Tod, erholte sich nicht. Der Krieg zwischen England und Frankreich und das Brigantentum, das er gebar, enthüllten die Hohlheit der militärischen Prätentionen des Rittertums und die Oberflächlichkeit seiner moralischen Ansprüche. Das Schisma erschütterte die Grundlagen der zentralen mittelalterlichen Institution und verbreitete ein tiefes und umfassendes Unbehagen. Die Menschen fühlten sich unkontrollierbaren Einflüssen unterworfen, wie Treibgut hin und her geworfen in einer Welt ohne Sinn und Richtung. Sie lebten in einer Epoche, die kämpfte und litt, ohne sichtbar voranzukommen. Sie sehnten sich nach Heilung, nach einer Erneuerung des Glaubens, nach einer Stabilität und Ordnung, die niemals kam.
Die Zeiten waren jedoch nicht statisch. Der Vertrauensschwund öffnete den Weg für die Veränderung, und das Elend, miseria, und gab diesem Impuls die Kraft. Die Unterdrückten hielten nicht länger aus, sondern rebellierten, wenn auch kaum gerüstet, eine neue Ordnung durchzusetzen. Dennoch: Veränderung fand, wie immer, statt. Wyclif und die protestantische Bewegung waren die natürliche Folge des Niederganges der Kirche. Die Monarchie, die zentrale Regierung, der Nationalstaat, gewannen an Kraft, sei es nun zum Guten oder zum Bösen. Die Schiffahrt, durch den Kompaß befreit, war den Entdeckungsreisen nahe, die die Grenzen Europas aufbrechen und die neue Welt finden sollten. Die Literatur, von Dante bis Chaucer, drückte sich in den Nationalsprachen aus, bereit für den großen Sprung, den die Buchdruckerkunst bringen sollte. (Spiegel, 513).
Bibliographie
Primärliteratur
o Froissart, Jean, Chroniques, herausgegeben von Siméon Luce, 14 Bände, Paris 1869-1966.
o La connaissance de la nature et du monde au moyen âge dʼaprès quelques écrits français à lʼusage des laïcs, herausgegeben von Charles Victor Langlois (1863-1929), Paris 1911.
o
Le
ménagier de Paris. Traité de morale et dʼéconomie domestique, composé vers
1393, par un bourgeois parisien, 2 Bände, Paris 1847; Genf 1965.
o Marsilius von Padua, Defensor pacis, herausgegeben von Richard Scholz, Hannover 1933.
o
Nangis,
Guillaume de, Jean de Venette und Hercule-Joseph-Pierre-François Géraud, Chronique latine de Guillaume de Nangis 113 à 1300 avec les
continuations de cette chronique de 1300 à 1368, Paris 1843.
o Notes et documents relatifs à Jean, Roi de France, et à sa captivité en Angleterre, herausgegeben von Henri dʼOrléans (1822-1897), Band 2, London 1855f.
o Ockham, Wilhelm von, Octo quæstiones de potestate papæ an princeps pro suo succursu possit recipere bona ecclesiarum, etiam invito papa, consultatio de causa matrimoniali, opus nonaginta dierum, herausgegeben von Jeffrey G. Sikes, Manchester 1940.
o Petrarca, Francesco, Epistolæ familiares XXIV, herausgegeben von Florian Neumann, Mainz 1999.
o Wyclif, John, Tractatus de universalibus, herausgegeben von Anthony J. Kenny, Oxford 1985.
Sekundärliteratur
o
Chambers,
Edmund Kerchever, The Medieval Stage, London 1903.
o
Croce,
Benedetto, Storia del regno di Napoli, Bari 21967.
o
Cutts,
Edward L., Scenes and Characters of the Middle Ages, London 1930.
o
Gayley,
Charles M., Plays of Our Forefathers, New York 1907.
o
MacKinnon,
James, The History of Edward the Third, London 1900; London 1974.
o Ruhe, Ernstpeter, Wissensvermittlung in Frage und Antwort. Der enzyklopädische Lehrdialog „Le livre de Sidrac“, in: Wissensliteratur im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Bedingungen, Typen, Publikum, Sprache, herausgegeben von H. Brunner und Norbert Richard Wolf, Wissensliteratur im Mittelalter, 8.: Schriften des Sonderforschungsbereichs 226 Würzburg/Eichstätt, Wiesbaden 1993, 26-35.
o
Thompson,
James Westfall, The Aftermath of the Black Death and the Aftermath of the Great
War, in: American Journal of Scientology, 1920, März.
© Dr. Heinrich Michael Knechten, Stockum 2024