Inhalt
Texte
in hebräischen Lehrbüchern
Struktur
des hebräischen Verbums
Deuterokanonisches
und Pseudepigraphen
Philosophie
und Welt des Geistes
Modernhebräische Bibliographie
Historische
Reisen durch das Heilige Land
Hebräisch lernen
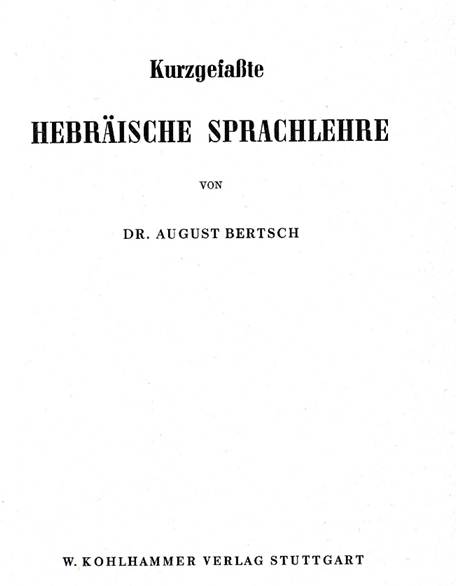
August Bertsch, Kurzgefaßte hebräische Sprachlehre, Stuttgart 1951, Titelseite
Anlaß
Es war eine große Gnade, daß ich an einem humanistischen Gymnasium lernen konnte: Latein wurde von Sexta bis Oberprima unterrichtet, Griechisch von Quarta bis Oberprima; nur fehlte leider Hebräisch. Daher machte ich mich selbst auf den Weg und besorgte mir ein Lehrbuch (Bertsch) und die hebräische Bibel (Kittel). Im Grunde genommen, kam ich mit meinem Lehrbuch ganz gut zurecht, aber die Erklärung des Verbums fand ich nicht eingängig.
Als ich dann auf der Hochschule ein anderes Lehrbuch hatte (Hollenberg-Budde), verstand ich sofort, worum es ging und wie anders als in den indoeuropäischen Sprachen die Struktur des semitischen Verbums war.
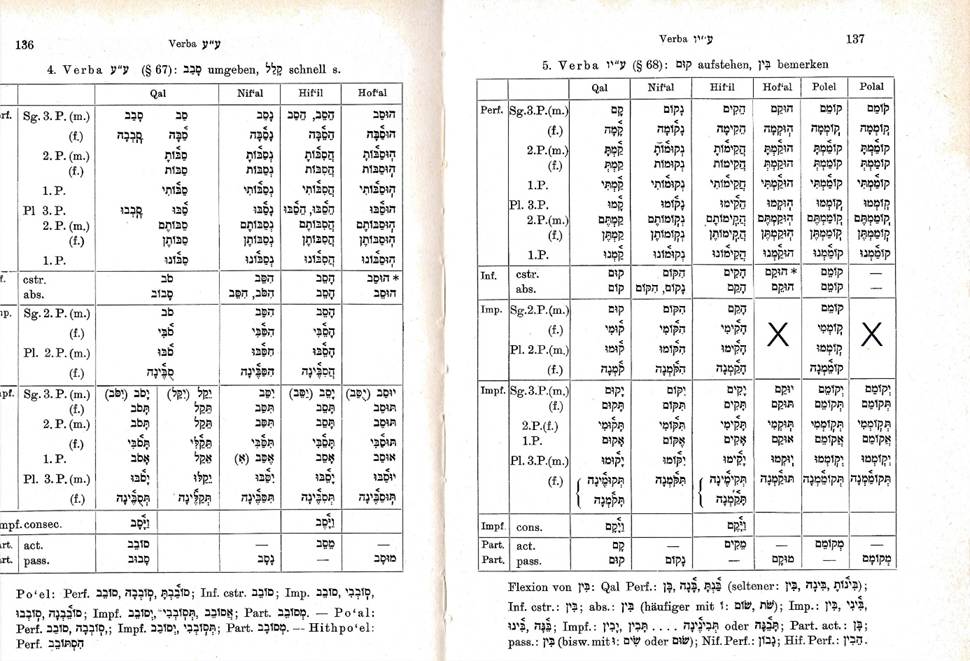
Bertsch, Paradigmen, Seite 136f
Sem, Cham und Japheth
Das Wort semitisch soll hier erklärt werden. Noaḥ hatte drei Söhne: Sem, Cham (Ḥam) und Japheth. Diese drei Namen wurden zu Bezeichnungen für Sprachfamilien.
Semitische Sprachen sind Akkadisch (Babylonisch-Assyrisch), Altsüdarabisch (Sabäisch), Arabisch, Aramäisch (mit Mandäisch), Äthiopisch, Kanaanäisch (Ammonitisch, Deir ʽAlla, Edomitisch, Hebräisch sowie Phönizisch-Punisch), Syrisch und Ugaritisch.
Hamitische Sprachen sind Altägyptisch (auch als hamito-semitisch bezeichnet), Berberisch, Tschadisch und Kuschitisch.
Mit den Nachkommen Japheths werden Bewohner der Mittelmeerinseln und Kleinasiens bezeichnet, also wohl Griechen und andere indoeuropäische Völker.
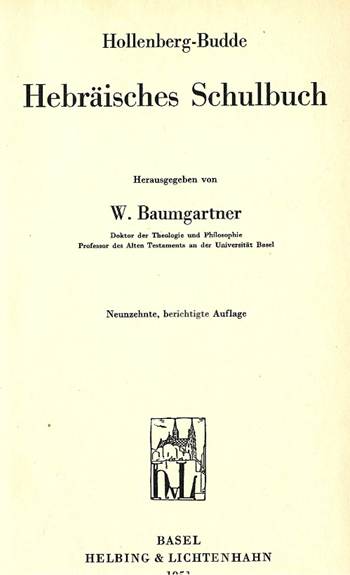
Hollenberg-Budde-Baumgartner, Basel 1951, Titelseite
Texte in hebräischen Lehrbüchern
August Bertsch beginnt seine hebräische Sprachlehre mit einer Einleitung, in welcher der Unterschied zwischen Alt- und Neuhebräisch erklärt wird, sowie die Zweige des semitischen Sprachstammes dargelegt werden. Es folgt die Schriftlehre, an die sich eine verhältnismäßig ausführliche Grammatik anschließt (Seite 36 bis 120). Paradigmen legen die Struktur der suffigierten Nomina (status absolutus und constructus sowie Possessivpronomina) und die Verbalflexion dar.
Gleichsam als Anhang erscheinen Übungsstücke (Seite 143 bis 167). Es handelt sich also um den Aufbau eines akademischen Buches.
Verdienstvoll ist, daß in allen sechzig Lektionen auch unpunktierte (unvokalisierte) Texte vorkommen. Auch gibt es Übersetzungsübungen vom Deutschen ins Hebräische. Dadurch ist die Brücke zur Lektüre neuhebräischer Texte geschlagen.
Für das Selbststudium ist förderlich, daß die Fundstellen zu den Übungen angegeben werden. So kann der Studierende seine Übersetzung überprüfen.
Der Hauptmangel des Buches aber ist, daß es sich um einzelne Sätze und Worte handelt, die aus dem Zusammenhang herausgegriffen wurden. Beispielsweise stehen in Lektion I Stellen aus Jesaja, Leviticus, Hosea, den Psalmen, Genesis, Sacharja, den Sprüchen und dem 1. Samuelbuch unverbunden nebeneinander.
Viel einprägsamer für das Lernen des Vokabulars und der Grammatik wäre es, fortlaufende erzählende Passagen auszuwählen.
Auch Hollenberg-Budde beginnt mit Grammatischem (Seite 1 bis 103), läßt dann Übungsstücke mit unverbundenen Ausdrücken folgen, auch mit deutsch-hebräischen Übersetzungsübungen (Seite 104 bis 136), wobei er keinen Schlüssel zu den jeweiligen Fundstellen gibt, aber dann folgen dankenswerterweise zusammenhängende Prosastücke, poetische und prophetische sowie unpunktierte Stücke (Seite 137-179), bei denen jeweils die Fundstelle angegeben ist.
Der Vorteil dieses Buches zeigt sich außerdem in der grammatischen Erklärung des Verbums.
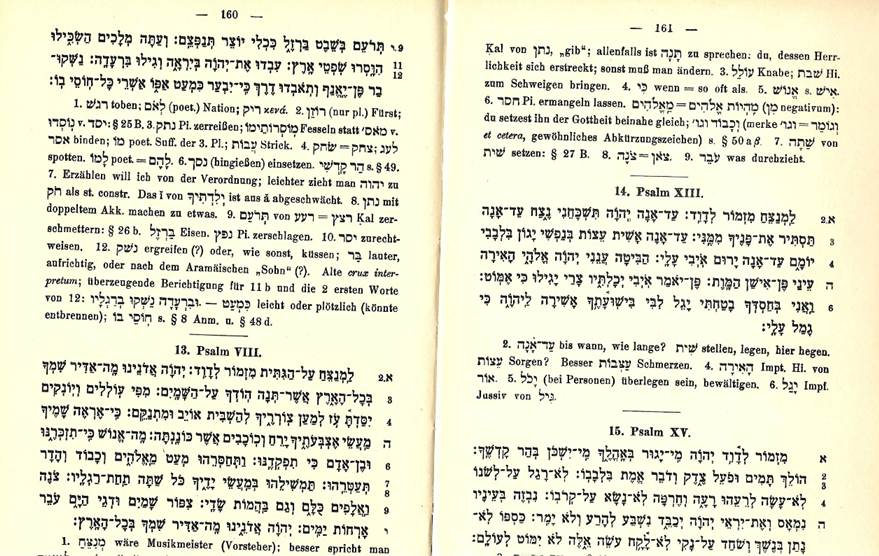
Hollenberg-Budde-Baumgartner, Seite 160f, Psalm 2; 8; 13 und 15.
Struktur des hebräischen Verbums
Bertsch erklärt Seite 77 zunächst die Entstehung des
hebräischen Verbums: Die ältesten Flexionsformen entwickelten sich aus der
Zusammensetzung eines Nomens oder Adjektivs mit einem Personalpronomen. Das
Nomen qӑṭāl – Mörder, eigentlich Töter,
ergab mit dem Personalpronomen tā – du qӑṭáltā> qӑṭắltā
(mit ursemitischer Kürzung des ā in geschlossener Silbe) das ist
Mörder-du.
Danach
(Seite 77f) legt Bertsch die Stammformen der Verba dar: Qal
– Grundstamm, Nifʽal – Reflexiv zum Qal, Piʽel – Intensivstamm, Puʽal – Passiv zum Intensivstamm, Hithpaʽel
– Reflexiv zum Intensivstamm, Hifʽil –
Kausativstamm und Hofʽal – Passiv zum
Kausativstamm. Es folgt eine kurze Erklärung des jeweiligen Stammes.
Ich
verstand damals (1965) überhaupt nichts.
Hollenberg-Budde
geht ganz anders vor:
„Die
starken Verbalstämme haben drei Konsonanten (Wurzelbuchstaben, Radikale). Die
Flexion beginnt mit der dritten Person als der einfachsten Form. Bei jedem
Verbum unterscheidet man den einfachen Grundstamm (קל, leicht, d. h. nicht durch Verdoppelung oder Bildungszusätze
beschwert) und die daraus durch innere Umbildung und äußere Zusätze abgeleitete
Stammbildungen (genera verbi), für
welche auch der Name Konjugationen (in einem ganz anderen Sinn als in anderen
Sprachen) üblich ist. Durch diese abgeleiteten Stämme wird die Bedeutung des
Grundstamms in bestimmter Weise verändert, vgl. fugere, fugare, fugitare;
fallen, fällen; stechen, stecken; schneiden, schnitzen, schneiteln, schnitzeln
usw.“ (Seite 22).
Da
diese Beschreibung praktischer Art ist, begriff ich das System sofort.
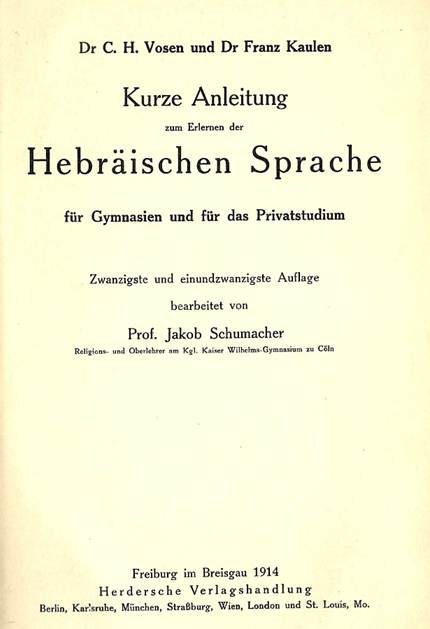
Vosen-Kaulen, Anleitung,
Freiburg 1914, Titelseite
Die
Bemerkung zu den Konjugationen entspricht der folgender
Ausführung in der Sprachlehre von Vosen-Kaulen (S. 20):
„Das
Verbum hat im Hebräischen wie in allen semitischen Sprachen die
Eigentümlichkeit, daß für die einzelnen Kategorien
der Bedeutung durch regelmäßige Ableitung verschiedene Stammformen gebildet
werden. Es gibt vier Hauptarten von Stammformen: Grund-, Reflexiv-,
Steigerungs-, Kausativstämme. Nach dem Vorgange der alten Grammatiker werden
sie (in einem ganz anderen Sinne wie bei den indogermanischen Sprachen) Konjugationen genannt.“
Die
hebräische Sprache lebte im nachbiblischen Schrifttum weiter. In der
rabbinischen Zeit entstand die Mišna (Wiederholung),
die älteste Zusammenfassung und Auslegung der Gesetze und damit die Grundlage
des Religionsgesetzes (Halacha).
Da die
aramäische Sprache vorherrschend war, färbte sie im Vokabular auf das mischnische Hebräisch ab. Zusammengesetzte Tempora wurden
vermehrt verwendet und der Narrativ fiel weg. Das Präsens wurde durch das
Partizip ausgedrückt. Dies wurde vom Modernhebräischen übernommen.
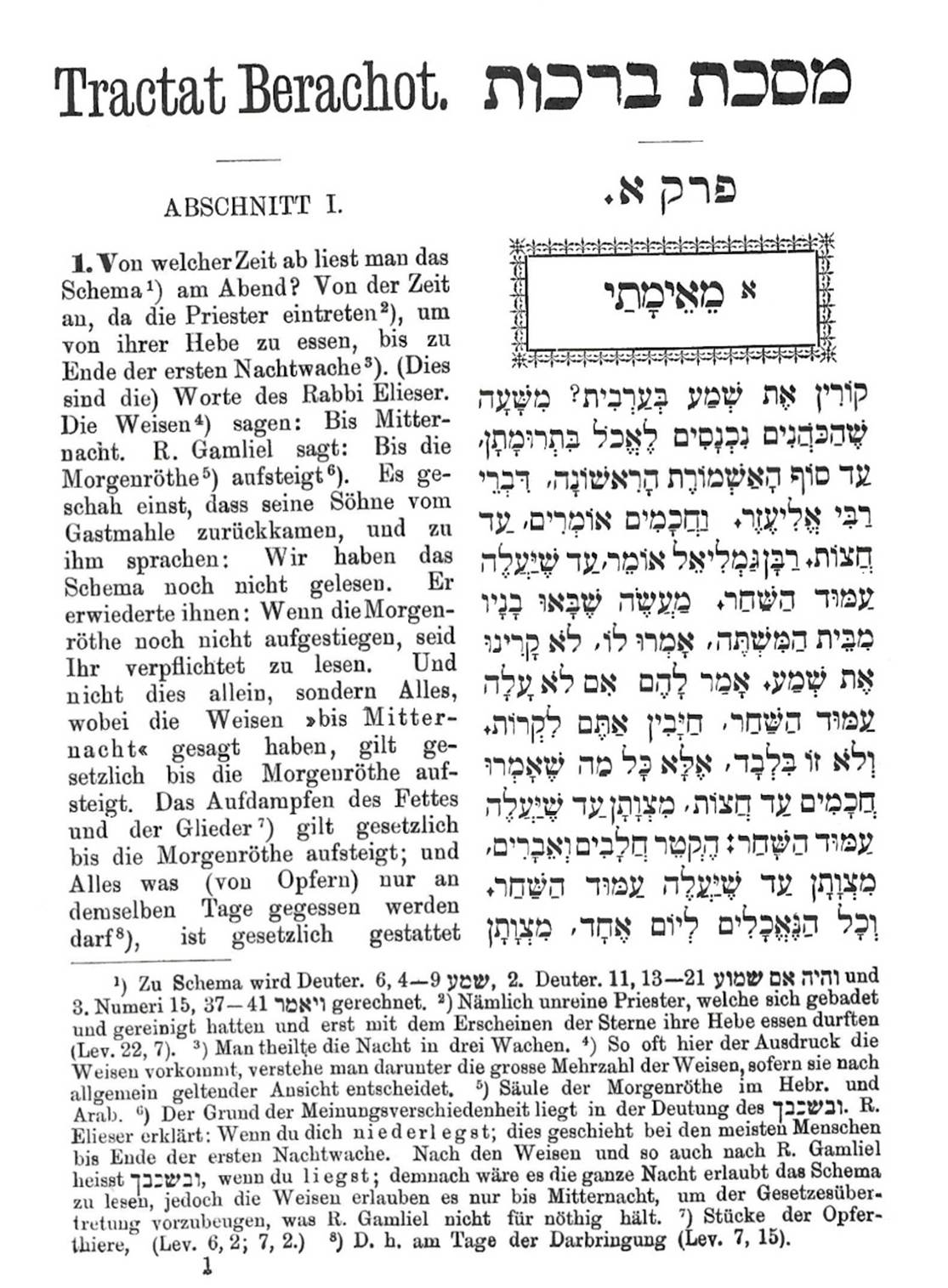
משניות (mišnajōṯ) Die sechs Ordnungen der Mischna,
Teil I: זרעים סדר
Ordnung der Saaten,
übersetzt und erklärt von Ascher Sammter, Basel 31993,
1.
Modernhebräisch lernen
Am
Institut für Judaistik der Universität Köln beschäftigte ich mich mit der
heutigen hebräischen Sprache. Ich nahm auch an einem Ulpan-Kurs in Israel teil.
אולפן (ulpan)
bedeutet Unterricht, Anweisung. Diese Methode entstand bereits im britischen
Mandatsgebiet Palästina und wurde 1948 offiziell in die Didaktik des Staates
Israel eingeführt. Es geht darum, von Anfang an Hebräisch zu sprechen.
Für
jemanden, der von der klassischen hebräischen Sprache herkommt, ist die heutige
Sprache zunächst einmal gewöhnungsbedürftig. Allerdings muß der Gerechtigkeit
halber hinzugefügt werden, daß auch das biblische Hebräisch fast immer auf
diese Weise ausgesprochen wird. Wer sich allerdings mit Akkadisch,
Altsüdarabisch, Arabisch. Aramäisch, Äthiopisch, Syrisch und Ugaritisch
beschäftigt hat, wird auch die biblischen Texte aussprechen, wie in dieser
Sprachenfamilie üblich. Im Ägyptischen gibt es ebenfalls einige dieser Phoneme,
während sie im Koptischen fortgefallen sind.
Hier
ist sicher eine Anmerkung ob der Fülle der genannten Sprachen notwendig. „Hans
Dampf in allen Gassen“. „Hochstapler“, „Angeber“ und „Oberflächlichkeit“ sind
die Assoziationen, die bei einer solchen Aufzählung kommen.
Dies
diene zur Erklärung: Als ich Orientalistik studierte, waren wir in den
Sprachkursen meist zu dritt: der Assistent des Professors, ein Arzt, welcher
früher in Bagdad gewirkt hatte, und ich. Es ist leicht vorstellbar, daß für
jeden angebotenen Kurs händeringend Teilnehmer gesucht wurden, damit er nicht
entfallen mußte. Insofern war es ein Akt der Barmherzigkeit, mitzumachen.
Zurück
zur üblichen Aussprache des Hebräischen:
o Lange Vokale werden im heutigen
Hebräisch kurz ausgesprochen,
o אַוּ au
wie aw,
o die Lispellaute
ṯ und ḏ (ת und ד ohne
Dageš) wie t und d,
o ח (ḥēṯ)
wie ch in ach,
o ט (ṭēṯ)
wie t,
o צ (צדי
ṣāḏē) wie ts,
o ק (qōf) wie k und
o ע (ʽajin) entfällt in der Aussprache.
Das heutige Hebräisch ist zu einer Literatursprache geworden. Einer der wichtigsten Autoren war Samuel Joseph ʽAgnon (1887-1970)..
Die hebräische Schrift
Auf der Sinaihalbinsel wurden Inschriften gefunden, welche die Entwicklung des ägyptischen Hieroglyphenalphabetes zum phönizischen und althebräischen belegen. Der Beginn dieses Überganges war im 19. Jahrhundert vor Christus.
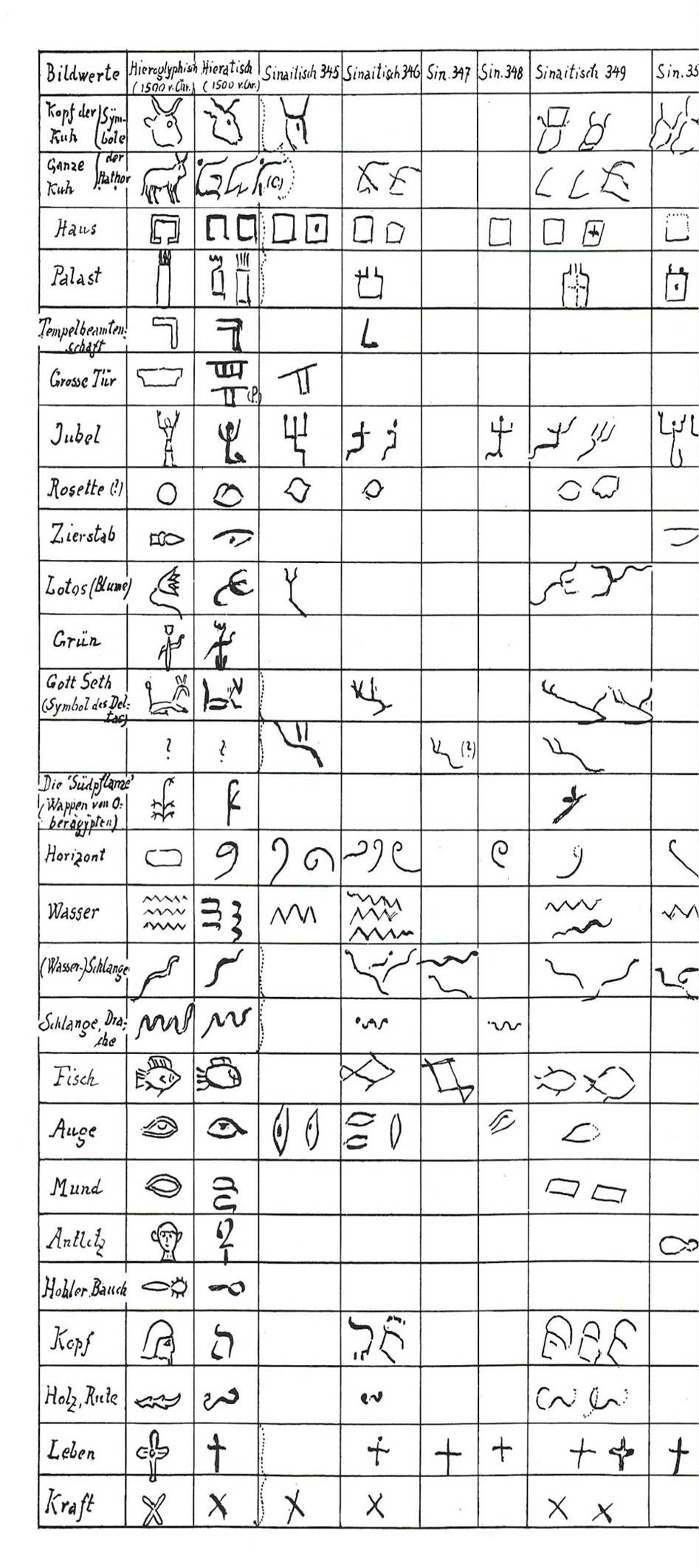
Hubert Grimme, Althebräische Schriften vom Sinai. Alphabet, Textliches, Sprachliches mit Folgerungen, Kulturen der Erde, Abteilung: Textwerke, Hannover 1923; Osnabrück 1988, 102.
Die althebräische Schrift entwickelte sich unter dem Einfluß der aramäischen Kursive zur Quadratschrift, die so heißt, weil fast jeder Buchstabe in ein Quadrat paßt:
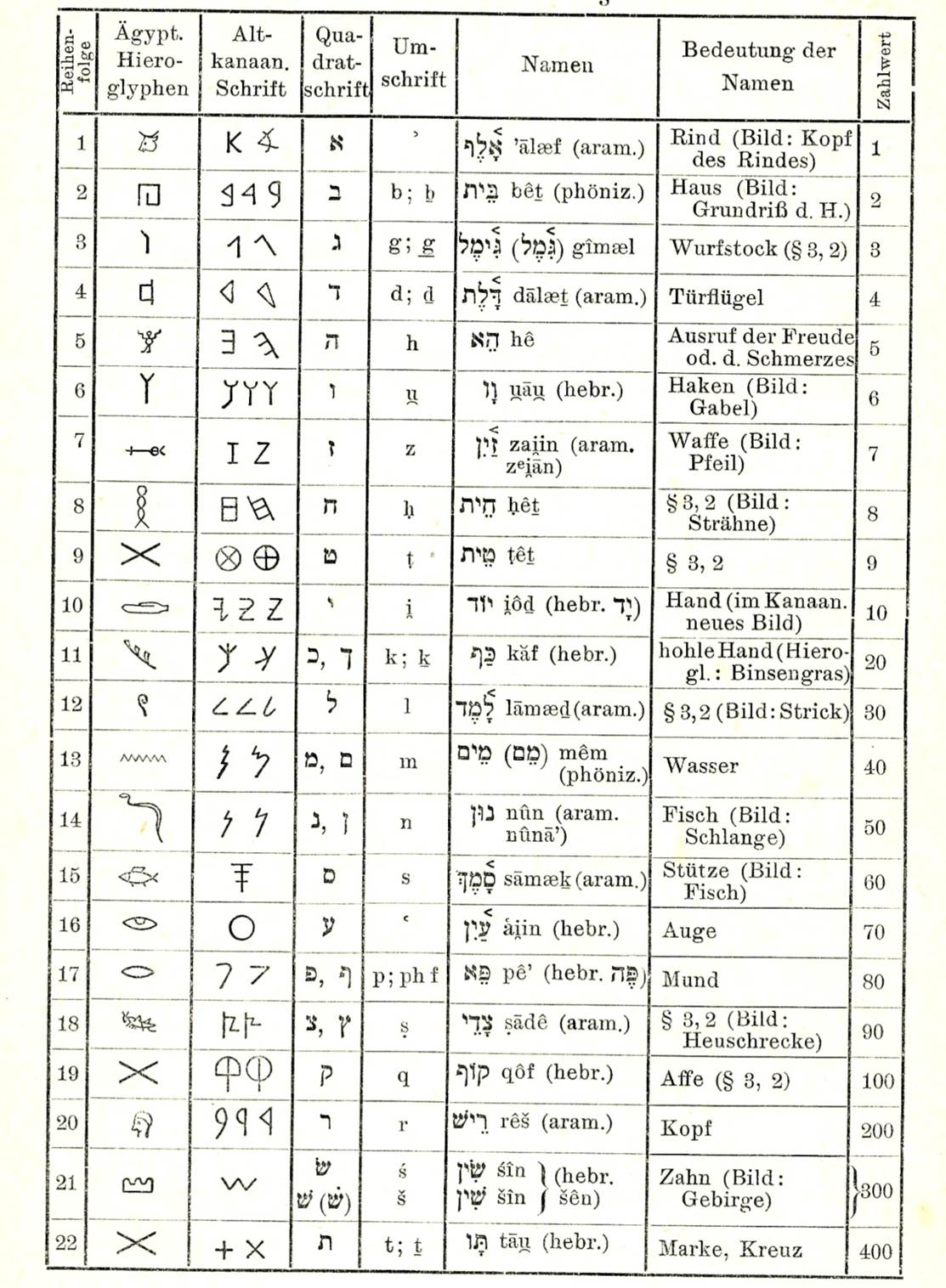
August Bertsch, Kurzgefaßte hebräische Sprachlehre, Stuttgart 1956, 24.
Die Mešaʽ-Inschrift
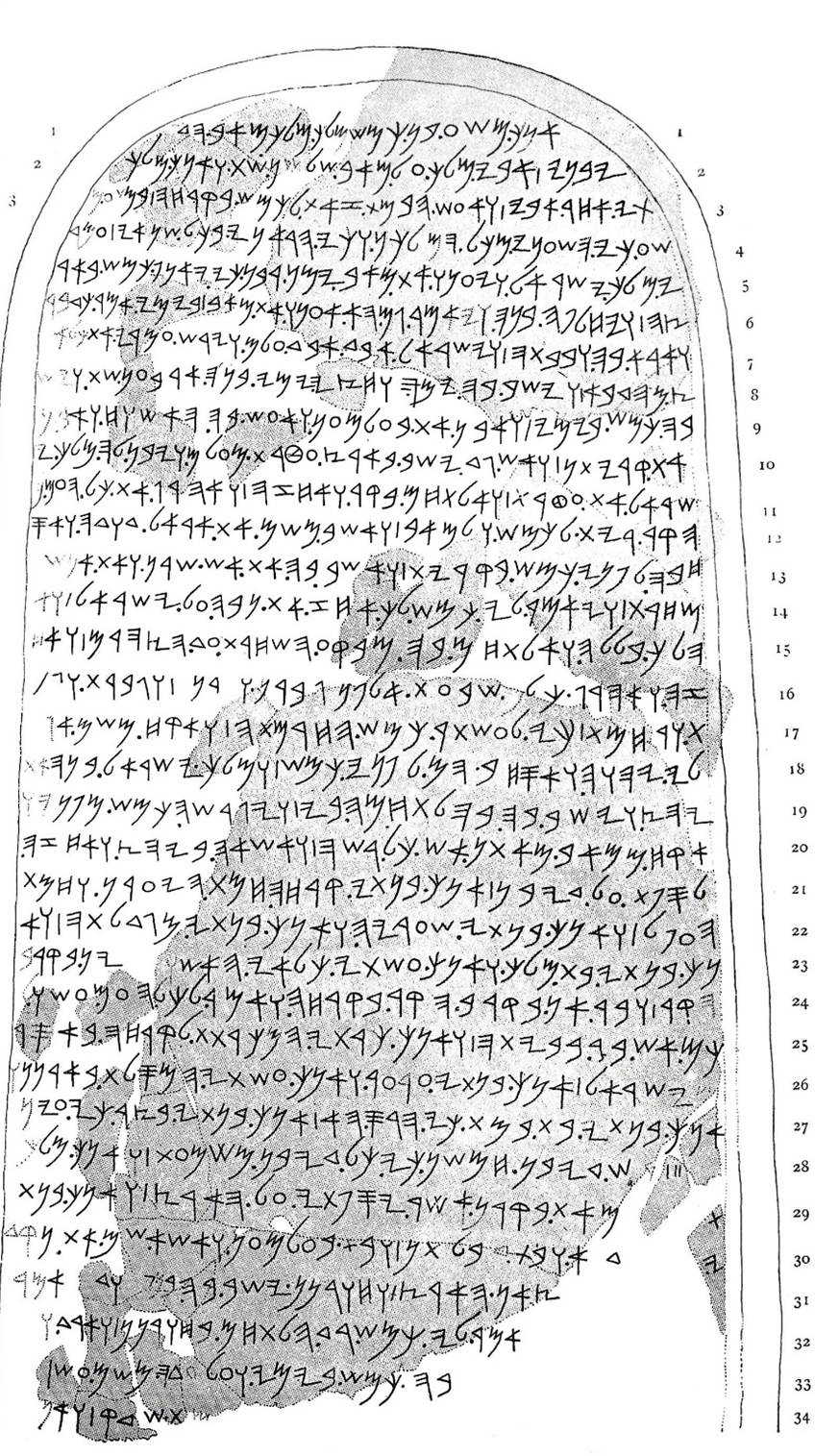
Mark Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik nebst ausgewählten Inschriften, Teil II: Tafeln, Weimar 1898; Hildesheim 1962, Tafel I: Die Mešaʽ-Inschrift. Zeile 1-3: „Ich bin Mōšiʽ [2 Kön 3, 4: מישע mēšaʽ; herrschte um 850 vor Christus], der Sohn des Kamōš[iyat]. der König von Moab aus [dem Ort] Daybon. Mein Vater herrschte dreißig Jahre über Moab, und ich wurde nach meinem Vater König. Da bestimmte ich diese Höhe für [den Gott] Kamōš in [dem Ort] Qarḥō zum Dank für die Rettung vor all den Königen und weil er mich über alle meine Feinde triumphieren ließ.“
Die Samaritaner
Die Samaritaner sind die Bewohner von Samaria mit der
Hauptstadt Sichem (שכם šəḵæm),
im Arabischen Nablus (νέα πόλις
néa pólis – Neustadt). Die
zehn Stämme Israels bildeten zwischen 927 und 922 ein eigenes Königreich im
Norden. Der expandierende Staat Assur deportierte aus diesem Territorium nicht
so viele Menschen wie aus dem Südreich Juda und
betrieb im Nordreich eine Politik der Vermischung verschiedener Völker. Von der
Babylonischen Gefangenschaft war das Nordreich nicht so stark betroffen. Nach
der Rückkehr der Exilierten galt die Bevölkerung in Samarien als
„andersgläubig“. Die Samaritaner erkennen nur die Tora (die fünf Bücher Moses)
in der samaritanischen Textform an, nicht aber die Propheten und die Schriften
(Psalmen und Weisheitsliteratur).
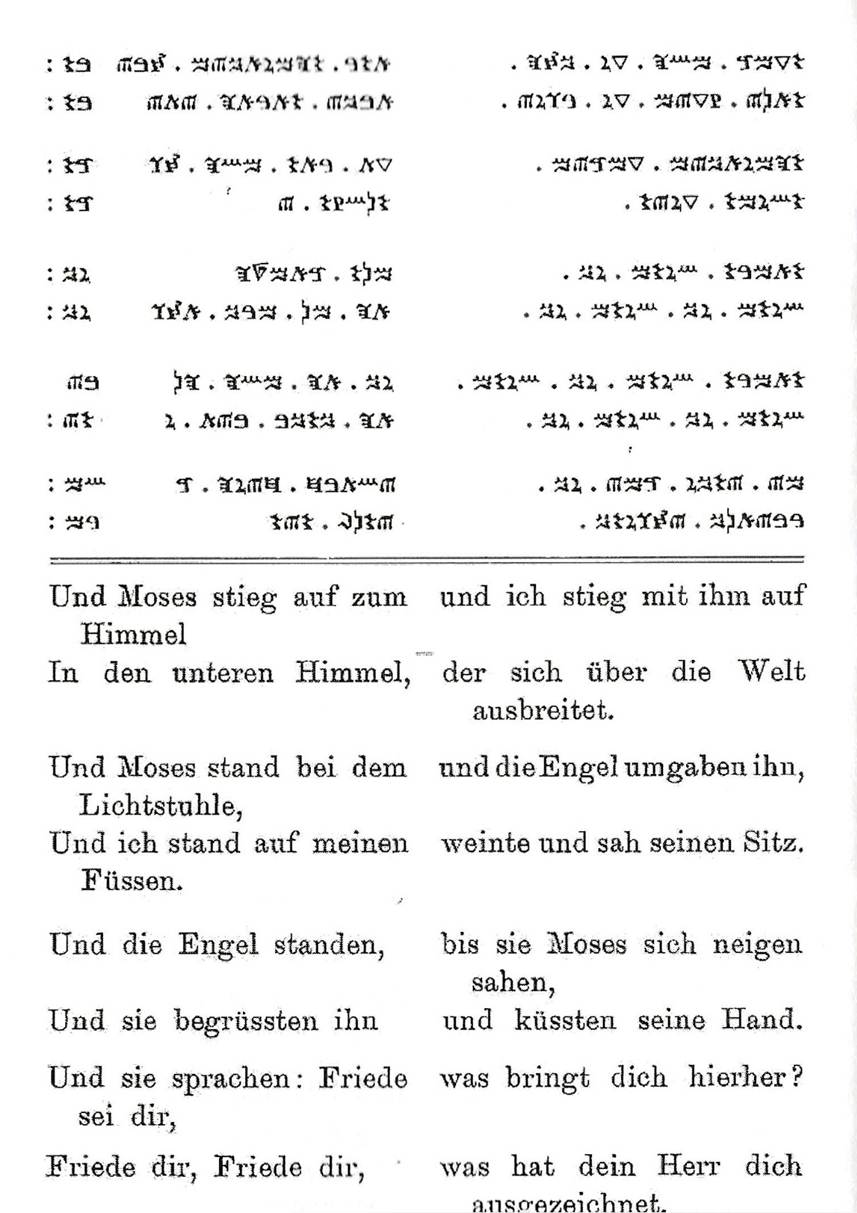
Der Traum des Priesters Abischa, in: Isaak Rosenberg, Lehrbuch der samaritanischen
Sprache und Kultur, Wien, Pest und Leipzig 1901, 150.
Qumran
Schriftrollen aus den Qumranhöhlen am Nordwestufer des Toten Meeres gelangten 1947 in den Antikenhandel. Seit Philo von Alexandria (um 15/10 vor Christus bis nach 40 nach Christus) war die Gemeinschaft der Esséner in Alexandria bekannt. Jetzt wurde allmählich essenisches Gedankengut in Schriftform veröffentlicht.
Qumran -
hebräische Texte
o Die Texte aus Qumran hebräisch und deutsch, herausgegeben von Eduard Lohse und Annette Steudel, 2 Bände, Darmstadt 1964 und 2001.
o
Muraoka,
Takamitsu, A Syntax of Qumran Hebrew, Löwen, Paris
und Bristol, CT 2020.
o
Muraoka,
Takamitsu, und John F. Elwolde, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben
Sira, Leiden 1997.
o
Penner,
Ken M., The Verbal System of the Dead Sea Scrolls. Tense, Aspect, and Modality
in Qumran Hebrew Texts, Studia Semitica Neerlandica, Band 64, Leiden 2015.
o Fabry, Heinz-Josef, und Ulrich Dahmen, Herausgeber, Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, 3 Bände, Stuttgart 2011.2013.2016.
o Der Lehrer der Gerechtigkeit, Johann Maier, Franz-Delitzsch-Vorlesung, Heft 5 (1995), Münster 1996; in: Studien zur jüdischen Bibel, Band 2, herausgegeben von Franz-David Hubmann und Josef Marius Oesch, Studia Judaica, Band 121, Berlin 2025, 191-228.
Qumran -
aramäische Texte
·
Die aramäischen Texte vom Toten Meer,
herausgegeben, übersetzt und gedeutet von Klaus Beyer, 2 Bände, Göttingen 1984
und 1994.
· Cook, Edward M., Dictionary of
Qumran Aramaic, University Park, Pennsylvania 2021.
· Muraoka, Takamitsu, A Grammar of
Qumran Aramaic, Ancient Near Eastern Studies, Supplement 38, Löwen 2011.
· Fabry, Heinz-Josef, und Ulrich Dahmen, Herausgeber, Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, 3 Bände, Stuttgart 2011.2013.2016.
· Machiela, Daniel, A Handbook of the Aramaic Scrolls from the Qumran Caves. Manuscripts, Language and Scribal Practices, Leiden und Boston 2023.
Einführung
· Einführung in die Qumranliteratur, Géza G. Xeravits (1971-2019), De Gruyter Studium, Berlin und Boston 2015.
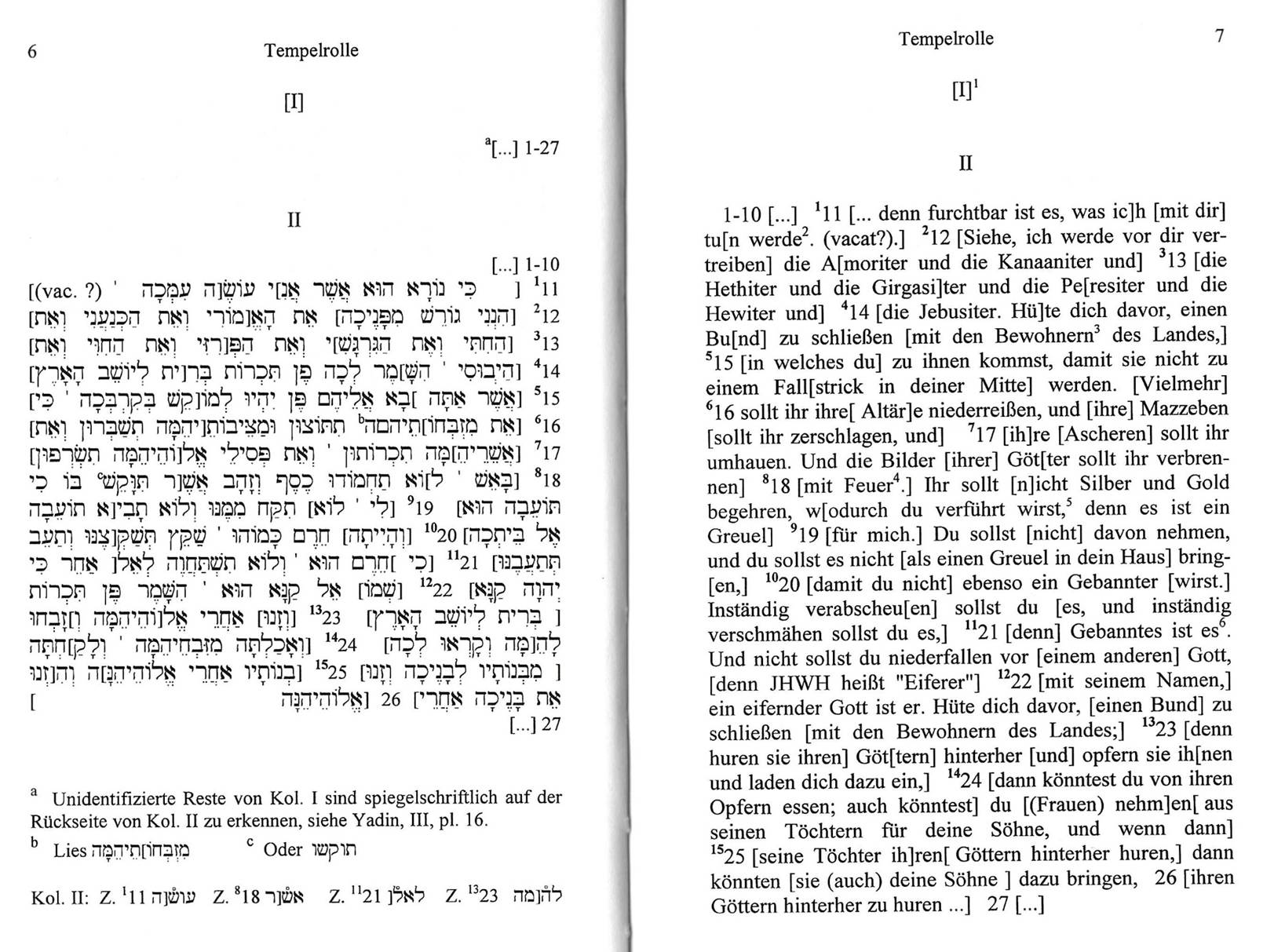
Der Beginn der Tempelrolle, herausgegeben von Annette Steudel, Darmstadt 2001, 6f.
Palästina
Palästinisches Arabisch
· Das palästinische Arabisch. Die Dialekte des Städters und des Fellachen. Grammatik, Übungen und Chrestomathie, Leonhard Bauer (1865-1964), Leipzig 1910; 1913; 1926; 41970.
· Der arabische Dialekt der Dörfer um Ramallah, Ulrich Seeger, 2 Bände, Semitica Viva, Band 44, Wiesbaden 2009.
· Wörterbuch des palästinischen Arabisch, deutsch-arabisch, Leonhard Bauer, Leipzig und Jerusalem 1933; Deutsch-arabisches Wörterbuch der Umgangssprache in Palästina und im Libanon, Wiesbaden 1957.
Palästinenser
· Das Palästinaproblem. Ursachen und Entwicklungen 1897-1948, Walid Khalidi, Rastatt 1970.
· Die Palästinenser. Mythen und Märtyrer, Johannes Gerloff, Muldenhammer (Vogtlandkreis, Sachsen) 2025.
· Die Palästinenser. Volk im Brennpunkt der Geschichte, Johannes Gerloff, Neuhausen 2006; Holzgerlingen (Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg) 2011; 2012.
Hebräische Bibliographie
Die
hebräische Schrift
· Einführung in die hebräische Schrift, Johannes Kramer und Sabine Kovallik, Hamburg 1994; 2005; 2017.
· Hebräische Schrift. Von der Steinschrift zum Poster, Susi Guggenheim-Weil, Ausstellung in Zürich, Zürich 1976; Neuausgabe mit Supplementband, Zürich 1987.
· Ivrit. Die hebräische Schrift lesen und schreiben lernen, Smadar Raveh-Klemke, Bremen 2004.
·
Liladenu – Für unsere
Kinder. Neue hebräische Lesefibel, Michael Abraham, Illustrationen von Oscar
Haberer, Frankfurt am Main 1931; Alephbeth. Die
hebräische Lesefibel für Anfänger, Einleitung von Andreas Nachama, Berlin 2015.
Biblisch-hebräische
Lehrbücher
o Bertsch, August (1887-1958), Kurzgefaßte hebräische Sprachlehre, Stuttgart 1956.
o Ewald, Georg Heinrich August (1803-1875), Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Bundes, Leipzig 1855; 1863.
o Hollenberg, Wilhelm Adolf (1824-1899), Hebräisches Schulbuch, Berlin 1861; herausgegeben von Johannes Hollenberg (1844?-1892), Berlin 1873; herausgegeben von Karl Ferdinand Reinhard Budde (1850-1935), Berlin 1895; herausgegeben von Walter Baumgartner (1887-1970), Berlin 1935; Basel 1951 (diese Ausgabe wird im vorliegenden Beitrag verwendet); Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testamentes. Neubearbeitung des „Hebräischen Schulbuchs“ von Hollenberg-Budde, , herausgegeben von Ernst Jenni (1927-2022), Basel und Stuttgart 1978; 1981; 2003; Basel und Berlin 2023.
o Lambdin, Thomas Oden (1907-2020), Introduction to Biblical Hebrew; Lehrbuch Bibel-Hebräisch, deutsche Bearbeitung von Heinrich von Siebenthal, Gießen 2006; 2021.
o Mattheus, Frank, Einführung in das Biblische Hebräisch, 2 Teile, Münster 1997.
o Neef, Heinz-Dieter, Arbeitsbuch Hebräisch. Materialien, Beispiele und Übungen zum Biblisch-Hebräisch, Tübingen 2015.
o Paganini, Simone, Bereschit. Lehrbuch Bibel-Hebräisch, Innsbruck 2013.
o Schröter, Ulrich (1939-2018), Biblisches Hebräisch. Textorientiertes Lehrbuch, Wiesbaden 2017.
o Strübind, Kim, Alef-Bet. Einführung in das biblische Hebräisch. Ein Lehrbuch mit Übungen, Tabellen und Vokabelverzeichnis, Hamburg 2023; 2024.
o Vosen, Christian Hermann (1815-1871), Kurze Anleitung zum Erlernen der Hebräischen Sprache für Gymnasien und für das Privatstudium, Freiburg im Breisgau 1853; umgearbeitete Auflage von Franz Philipp Kaulen (1827-1907), Freiburg im Breisgau 1874; neubearbeitet und herausgegeben von Franz Philipp Kaulen, Freiburg im Breisgau 1878; bearbeitet von Jakob Schumacher (1861/1862-1922), Freiburg im Breisgau, Berlin, Karlsruhe, München, Straßburg, Wien, London und St. Louis, Mo. 1914; 1922; 1931.
Biblisch-hebräische
Grammatiken
o Bauer, Hans (Johannes; 1878-1937), und Pontus Adalbert Leander (1872-1935), Historische Grammatik der hebräischen Sprache des Alten Testamentes, Halle 1922; Hildesheim, Zürich und New York 1991.
o Beer, Georg (1865-1946), Hebräische Grammatik, Sammlung Göschen, Berlin 1952.1955.
o Bergsträßer, Gotthelf (1886-1933), mit einem Beitrag von Mark (Abraham Mordechai) Lidzbarski (1868-1928), Hebräische Grammatik, Leipzig 1918; Hildesheim, Zürich und New York 1995.
o Brockelmann, Carl, Hebräische Syntax, Neukirchen 1956.
o Gesenius, Heinrich Friedrich Wilhelm (1786-1842), Hebräische Grammatik, Halle 1813; herausgegeben von Emil Rödiger (1801-1874), Leipzig 1845; herausgegeben von Emil Friedrich Kautzsch (1841-1910), mit Beiträgen von Julius Euting (1839-1913) und Mark Lidzbarski, Leipzig 1878; Leipzig 1909; Hildesheim, Zürich und New York 1995.
o Grether, Oskar, Hebräische Grammatik für den akademischen Unterricht, München 1951; 1955.
o Krause, Martin, Hebräisch. Biblisch-hebräische Unterrichtsgrammatik, herausgegeben von Michael Pietsch und Martin Rösel, Berlin und New York 2008.
o Meyer, Rudolf (1909-1981), Hebräische Grammatik, Sammlung Göschen, 4 Bände, Berlin 1972; in einem Band, mit einem bibliographischen Nachwort von Udo Rüterswörden, Berlin und New York 1992.
o Schneider, Wolfgang, Grammatik des biblischen Hebräisch. Ein Lehrbuch, München 1974; 1993.
Biblisch-hebräischer
Wortschatz
o Arnet, Samuel, Wortschatz der hebräischen Bibel. Zweieinhalbtausend Vokabeln, alphabetisch und thematisch geordnet, Zürich 2006.
o Hoppe, Juni, in Zusammenarbeit mit Josef Tropper, Hebräisch. Lernvokabular. 500 Vokabeln, thematisch angeordnet in 60 Lektionen, zum täglichen Lernen und Wiederholen, Hebraica et Semitica Didactica, Band 1, Kamen 2009.
o Stähli, Hans-Peter, Hebräisch-Vokabular. Grundwortschatz, Formen, Formenanalyse, Göttingen 1984.
Biblisch-hebräische
Wörterbücher
o Botterweck, G. Johannes, Heinz-Josef Fabry und Helmer Ringgren, Herausgeber, Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, 9 Bände, Stuttgart, Berlin, Köln und Mainz 1973-2000.
o Gesenius, Wilhelm, Hebräisch-deutsches Wörterbuch über die Schriften des Alten Testaments, 2 Teile, Leipzig 1810.1812; Neues hebräisch-deutsches Handwörterbuch mit Einschluß des biblischen Chaldaismus, Leipzig 1815; Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Leipzig 1886; in Verbindung mit Friedrich David Heinrich Zimmern (1862-1931), Wilhelm Max Müller (1823-1909) und Otto Weber (1877-1928) bearbeitet von Frants Peder William Meyer Buhl (1815-1932), Leipzig 1915; Berlin, Göttingen und Heidelberg 1962.
o Köhler, Ludwig (1880-1956), und Walter Baumgartner (1887-1970), Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden 1953; Wörterbuch zum hebräischen Alten Testament in deutscher und englischer Sprache, Leiden 1958; Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, herausgegeben von Walter Baumgartner, Johann Jakob Stamm und Benedikt Hartmann unter Mitarbeit von Edward Yechezkel Kutscher (1909-1971), Zeʼev Ben Ḥayyim und Philippe H. Reymond, 6 Bände, Leiden 1967.1974. 1983.1990.1995.1996.
Mischnisches Hebräisch
o Albrecht, Karl, Neuhebräische Grammatik aufgrund der Mišna, Clavis Linguarum Semiticarum, Teil V, München 1913.
o
Segal,
Moše Tsevi, A Grammar of Mishnaic Hebrew, Oxford
1927; 1970; 1979; 1986; 2001.
Samaritanisches
Hebräisch
o Macuch, Rudolf (1919-1993), Grammatik des samaritanischen Hebräisch, Studia Samaritana, Band I, Berlin 1969.
o Rosenberg, Isaak., Lehrbuch der samaritanischen Sprache und Literatur mit Facsimile eines samaritanischen Briefes des gegenwärtigen samaritanischen Hohenpriesters zu Nablus, Die Kunst der Polyglottie, Band 71, Wien, Pest und Leipzig 1901; Erfurt 2018.
o Taqi ben Taufiq ben Ḫiḍr Isḥāq Ğazal, Tarğumān. Glossar Samaritanisch-Arabisch, o. O. 1929.
Hebräische
Etymologie
o
Klein,
Ernest, Vorwort von Ḥayim Rabin, A Comprehensive Etymological
Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English, Jerusalem 1987.
o
Orël, Vladimir Ėmmanuilovič (1952-2007), und Olʼga
Valerʼevna
Stolbova, Hamito-Semitic Etymological Dictionary. Materials for a
Reconstruction, Handbuch der Orientalistik,
Band 18, Leiden, New York und Köln 1995.
o
Tawil,
Ḥayim ben
Yosef, An Akkadian Lexical Companion to Biblical Hebrew. Etymological-Semantic
and Idiomatic Equilents with Supplement on Biblical
Aramaic, Jersey City, NJ 2009.
Hebräische Namenkunde
o Jenni, Ernst, und Martin A. Klopfenstein, Beiträge zur hebräischen und altorientalischen Namenkunde. Johann Jakob Stamm. Zu seinem 70. Geburtstag, Freiburg im Üechtland und Göttingen 1980.
o Stamm, Johann Jakob (1910-1993), Der Name des Königs David, in: Vetus Testamentum. Supplementa 7 (1960), 176-183.
o Stamm, Johann Jakob, Der Name des Königs Salomo, in: Theologische Zeitschrift 16 (1960), 285-297.
o Stamm, Johann Jakob, Der Name Isaak, in: Festschrift für A. Schädelin, Bern 1950, 33-38.
o Stamm, Johann Jakob, Der Name Jeremia, in: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 100 (1988), Supplement, 100-106.
o
Stamm,
Johann Jakob, Hebräische Ersatznamen,
in: Studies in Honor of Benno Landesberger on His
Seventy-Fifth Birthday, in: Assyriological Studies
16, Chicago 1965, 413-424.
o Stamm, Johann Jakob, Hebräische Frauennamen, in: Hebräische Wortforschung. Festschrift zum 80. Geburtstag von Walter Baumgartner, in: Vetus Testamentum. Supplementa 16 (1967), 301-339.
o Stamm, Johann Jakob, Namengebung im Alten Testament, in: Religion in Geschichte und Gegenwart3 4 (1960), 1300f.
o Stamm, Johann Jakob, Namen rechtlichen Inhalty, in: Beiträge zur alttestamentlichen Theologie. Festschrift für Walter Zimmerli zum 70. Geburtstag, herausgegeben von H. Donner, R. Hanhart und R. Smend, Göttingen 1977, 460-478.
o Stamm, Johann Jakob, Personennamen im Alten Testament, in: Biblisch-historisches Handwörterbuch 3 (1966), 1426-1429.
Aramäische Bibliographie
Altaramäische
Lehrbücher
·
Margolis, Max Leopold
(1866-1932), Lehrbuch der aramäischen Sprache des Babylonischen Talmuds.
Grammatik, Chrestomathie und Wörterbuch, Clavis Linguarum
Semiticarum, Teil III, München 1910.
· Nicolae, Daniel, und Josef Tropper, Biblisch-Aramäisch kompakt, Hesed. Hebraica et Semitica Didactica, Band 2, Kamen 2010; 2013.
Altaramäische
Grammatik
· Segert, Stanislav (1921-2005), Altaramäische Grammatik mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar, Leipzig 1975; 1983; 1986; 1990.
Biblisch-aramäische
Grammatiken
· Bauer, Johannes (1878-1937), und Pontus Adalbert Leander (1872-1935), Grammatik des Biblisch-Aramäischen, Halle an der Saale 1927; Hildesheim, Zürich und New York 1962; 1969; 1981; 1995.
· Kautzsch, Emil Friedrich, Grammatik des Biblisch-Aramäischen. Mit einer kritischen Erörterung der aramäischen Wörter im Neuen Testament, Leipzig 1884.
Samaritanisch-aramäische
Grammatik
· Macuch, Rudolf (1919-1993) , Grammatik des samaritanischen Aramäisch, Studia Samaritana, Band IV, Berlin 1982.
Targumisch-aramäische Grammatik
· Dalman, Gustaf Hermann (1855-1941), Grammatik des Jüdisch-Palästinischen Aramäisch. Nach den Idiomen des Palästinischen Talmud, des Onkelostargum und Prophetentargum und der Jerusalemischen Targume. Aramäische Dialektproben, Leipzig 1894; 1905; Darmstadt 1960; 1978; 1981; 1989.
Babylonisch-talmudisch-aramäische
Grammatik
· Frank, Yiṣḥak, Grammar for Gemara. An Introduction to Babylonian Aramaic, Jerusalem 1975; 1995; Grammar for Gemara and Targum Onkelos. An Introduction to Aramaic, Jerusalem 2016.
· Schlesinger, Michel, Satzlehre der aramäischen Sprache des Babylonischen Talmuds, Veröffentlichungen der Alexander-Kohut-Stiftung, Band I, Leipzig 1927; Hildesheim, Zürich und New York 1995.
Christlich-palästinensisch-aramäische
Grammatik
· Müller-Kessler, Christa, Grammatik des Christlich-Palästinisch-Aramäischen, Texte und Studien zur Orientalistik, Band 6, Hildesheim, Zürich und New York 1991.
Biblisch-aramäisches
Wörterbüch
· Gzella, Holger, Aramäisches Wörterbuch, Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Band IX, Stuttgart 2016.
Samaritanisch-aramäisches
Wörterbuch
·
Altenmüller, H., und Avraham
Ṭal,
A Dictionary of Samaritan Aramaic, Handbook of Oriental
Studies, Abteilung 1: Der Nahe und der Mittlere Osten, Band 50, 2 Bände, Leiden
und Boston 2000.
Wörterbücher
zu Targum, Talmud und Midrasch
· Dalman, Gustaf Hermann, Aramäisch-Neuhebräisches Handwörterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch, Frankfurt am Main 1901; Frankfurt am Main 1922; Göttingen 1938; Hildesheim, Zürich und New York 1987.
· Frank, Yiṣḥak,
The Practical Talmud Dictionary, Jerusalem 1991; 1994; 2001; 2016.
· Jastrow, Marcus, ספר
מלים . Dictionary of the Targumim, Talmud Babli, Yerushalmi and Midrashic
Literature, 2 Bände, New York 1903; 1996.
· Levy, Jacob, Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim nebst Beiträgen von Heinrich Leberecht Fleischer, 4 Bände, Leipzig 1876. 1879. 1883. 1889; Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, Nachträge und Berichtigungen von Lazarus Goldschmidt, Berlin und Wien 1924; Darmstadt 1963.
· Sokoloff, Michael, A Dictionary of
Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geontic
Periods, Dictionarys of Targum, Talmud and Midrash,
Band III, Publications of the Comprehensic Aramaic
Lexicon Project, Ramat-Gan, Baltimore und London 2002.
· Sokoloff, Michael, A Dictionary of
Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period, Dictionarys
of Targum, Talmud and Midrash, Band II, Publications of the Comprehensic
Aramaic Lexicon Project, Ramat-Gan, Baltimore und London 2002.
Christlich-palästinensische
und syropalästinensische Wörterbücher
· Schulthess, Friedrich, Lexicon Syropalæstinum, Berlin 1903.
· Schwally, Friedrich Zacharias (1863-1919), Idioticon des christlich-palästinensischen Aramäisch, Gießen 1893.
Altaramäische
Textausgaben
·
Müller-Kessler,
Christa, The Catechism of Cyril of Jerusalem in the Palestinian Aramaic
Version, Corpus of Christian Palestinian Aramaic, Band V, Groningen 1999.
· Müller-Kessler, Christa, und Michael
Sokoloff, The Christian Palestinian Aramaic. New Testament Version from the
Early Period Gospels, Corpus of Christian Palestinian Aramaic, Band II A,
Groningen 1998.
· Müller-Kessler, Christa, The
Christian Palestinian Aramaic. Old Testament and Apokrypha
Version from the Early Period, Corpus of Christian Palestinian Aramaic, Band I,
Groningen 1997.
· Rosenthal, Franz (1914-2003), An Aramaic Handbook, Porta Linguarum Orientalium Neue Folge X, 4 Bände, Wiesbaden 1967.
· Schwiderski, Dirk, unter Mitarbeit von Walter Bührer und Benedikt Hensel, Die alt- und reichsaramäischen Inschriften, Band 1: Konkordanz, Fontes et Subsidia ad Bibliam pertinentes, Band 4, Berlin 2008; Band 2: Texte und Bibliographie, Fontes et Subsidia ad Bibliam pertinentes, Band 3, Berlin 2004.
Mandäisch
Mandäisch ist eine südostaramäische Sprache. Sie wird von den Mandäern, einer gnostischen Religionsgemeinschaft, verwendet, die von Mani (216-276) gegründet worden war.
·
Lidzbarski, Mark
(Abraham Mordechai; 1861-1928), Das Johannesbuch der Mandäer,
Gießen 1915.
· Lidzbarski, Mark, Ginza. Der Schatz oder Das große Buch der Mandäer, Göttingen 1925; Quellen der Religionsgeschichte, Band 13, Gruppe 4, Göttingen 1978. (Übersetzung und Erklärung).
· Macuch, Rudolf (1919-1993), Handbook
of Classical and Modern Mandaic, Berlin 1965.
· Petermann, Julius Heinrich (1801-1876), Ginza smāla und yamīna, in: Thesaurus sive Liber Magnus, Leipzig 1867.
Literatur
zum Altaramäischen
·
Altheim, Franz, und Ruth Stiehl, Die aramäische
Sprache unter den Achaimeniden. Geschichtliche
Untersuchungen, 3 Lieferungen des ersten BandesFrankfurt
am Main 1959-1963.
· Gzella, Holger, A Cultural History of Aramaic from the Beginning to the Advent of Islam, Handbook of Oriental Studies, Section: The Near and Middle East 111, Leiden 2015; Aramäisch. Weltsprache des Altertums. Eine Kulturgeschichte von den neuassyrischen Königen bis zur Entstehung des Islams, München 2023.
Neuaramäisch
·
Arnold, Werner, Lehrbuch des Neuwestaramäischen,
Vorwort von Otto Jastrow, Semitica
Viva. Series Didadctica, Band 1, Wiesbaden 1989;
2006.
· Bergsträßer, Gotthelf (1886-1933), Glossar des neuaramäischen Dialekts von Maʽlūla, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 15, 4, Leipzig 1921; Nendeln (Liechtenstein) 1966
· Jastrow, Otto, Laut- und Formenlehre des neuaramäischen Dialekts von Midin im Tūr Abdin, Wiesbaden 1967; 1993.
· Jastrow, Otto, Lehrbuch der Ṭuroyo-Sprache, Semitica Viva. Series Didactica, Band 2, Wiesbaden 1992; 2002.
· Jastrow, Otto, und Shabo Talay, Der neuaramäische Dialekt von Midyat (Miḏyoyo, Wiesbaden 2019.
· Sabar, Yona, A Jewish Neo-Aramaic
Dictionary, Semitica Viva, Band 28, Wiesbaden 2002.
· Spitaler, Anton (1910-2003), Grammatik des neuaramäischen Dialekts von Maʽlūla, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 23, 1, Leipzig 1938; Nendeln (Liechtenstein) 1966.
· Waltisberg, Michael, Syntax des Ṭuroyo, Wiesbaden 2016.
Tanach
Tanach bezeichnet als Abkürzung für: Tora (Weisung, die fünf Bücher Moses), Nebiʼim (Propheten) und Ketuvim (Schriften) die Hebräische Heilige Schrift.
Biblia Hebraica, ed. Kittel (BHK)
Grundlage für diese Edition war die sogenannte Rabbinerbibel, herausgegeben von Jakob ben Ḥayim ibn Adoniya (geboren um 1470, gestorben vor 1538), Venedig 1524/1525 bei Daniel Bomberg. Die Rand- und weitergehenden Notizen (Masora parva et magna) fehlten. Im kritischen Apparat gab Kittel Textvarianten aus masoretischen Handschriften und antiken Übersetzungen an, vor allem aus der Septuaginta, aus dem samaritanischen Pentateuch und aus der Vulgata.
Die Masoreten (Überlieferer, vom aramäischen mesăr) brachten zwischen 780 und 930 in Tiberias (am See Genezareth) die Vokalisation und Akzentsetzung in den Bibeltext ein, der bisher nur mit Konsonanten überliefert worden war. Sie stützten sich bei dieser Arbeit auf die mündliche Tradition, folgten aber den Aussprache- und Gesangstraditionen, die sich allmählich eingebürgert hatten und nicht immer die ältesten waren. Daher haben die alten Übersetzungen hohen Wert; denn sie geben einen vormasoretischen Text wieder.
Paul Kahle verwandte als Grundlage für die zweite Auflage (1937) den Codex Leningradensis aus St. Petersburg. Dieser älteste vollständige masoretische Text stammt aus dem Jahre 1008 nach Christus. Kahle nahm auch die Masora parva auf. Mitherausgeber waren Georg Albrecht Alt und Otto Eißfeldt.
Seit dem Jahr 1951 wurden Varianten aus Qumranhandschriften in einem eigenen kritischen Apparat angegeben, nämlich aus Jesaja und Habakuk.
· Biblia Hebraica, herausgegeben von Rudolf Kittel (1863-1929), Leipzig 1906; herausgegeben von Paul Kahle, 2 Bände, Stuttgart 21929-1937. (Die zahlreichen Nachdrucke werden nicht angegeben.)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS)
Für diese dritte Auflage, die zunächst in Einzelbänden erschien und ab 1977 vollständig vorlag, wurde der Codex Leningradensis nochmals herangezogen. Die Bücher 1 und 2 Chronik wurden, wie im Codex Leningradensis, an den Schluß des Buches gestellt.
Für die vierte Auflage (1990) wurden der textkritische Apparat und die Masora überarbeitet.
· Biblia Hebraica Stuttgartensia, herausgegeben von Karl Elliger und Wilhelm Rudolph, unter Mitarbeit von Hans Peter Rüger, Joseph Ziegler und Gerard Emmanuel Weil, Stuttgart 31967-1977; 41990.
· The Masorah
of Biblia Hebraica Stuttgartensia. Introduction and
Annotated Glossary, Page H. Kelley, Daniel S. Mynatt und Timothy G. Crawford,
Grand Rapids, Michigan und Cambridge (UK) 1998; Die Masora der Biblia Hebraica Stuttgartensia.
Einführung und kommentiertes
Glossar, Übersetzung von
Martin Rösel, Stuttgart 2003.
Biblia Hebraica Quinta (BHQ)
Da neue Handschriften aufgetaucht waren und sich auch die textkritische Erforschung weiterentwickelt hatte, wurde eine neue Auflage initiiert. Der textkritische Apparat ist größer geworden und zusätzlich folgt ein ausführlicher Kommentar, sowohl zu den Textvarianten als auch zur Masora parva et magna.
· Biblia Hebraica Quinta, herausgegeben von A. Schenker, Y. A. P. Goldman, A. van der Kooij, G. J. Norton, S. Pisano, J. de Waard und E. D. Weis, Stuttgart 52004ff. Bisher sind neun Bände erschienen: Genesis, Leviticus, Deuteronomium, Richter, Zwölfprophetenbuch, Hiob, Sprichwörter, Megilloth (Ruth, Hoheslied, Qoheleth, Klagelieder und Esther) sowie Esra und Nehemia.
Philippson und Zunz
· Die Israelitische Bibel, Ludwig Philippson (1811-1889), 3 Bände, Leipzig 1839.1841.1844; 1849.1854.1858; Die hebräische Bibel, revidiert von Walter Homolka, Hanna Liss und Rüdiger Liwak, 3 Bände, Freiburg im Breisgau, Basel und Wien 2015f; 2018; 2021.
· Die vier und zwanzig Bücher der Heiligen Schrift, nach dem masoretischen Texte unter der Redaction von Leopold Zunz (Jom Tov Lippmann Zunz; 1794-1886) übersetzt von H. Arnheim, Julius Fürst und M. Sachs, Berlin 1837-1839; 1866; Basel 1980: 1995; Tel Aviv 1997; Tel Aviv und Stuttgart 2008.
Buber-Rosenzweig
· Die fünf Bücher der Weisung, Martin Buber und Franz Rosenzweig, 5 Bände, Berlin 1934; Die Schrift, Band 1, Köln und Olten 1954; Heidelberg 1987; Stuttgart 1992; Gütersloh 2021.
· Bücher der Geschichte, Martin Buber und Franz Rosenzweig, Die Schrift, Band 2, Berlin 1934; Köln und Olten 1956; Stuttgart 1992; Gütersloh 2021.
· Bücher der Kündung, Martin Buber und Franz Rosenzweig, Die Schrift, Band 3, Berlin 1934: Köln und Olten 1966; Stuttgart 1992; Gütersloh 2021.
· Das Buch der Preisungen, Martin Buber, Berlin 1935.
· Die Schriftwerke, Martin Buber, Die Schrift, Band 4, Köln und Olten 1962; Stuttgart 1992; Gütersloh 2021.
Plaut
· The Torah. A Modern Commentary, herausgegeben von W. Günther Plaut, New York 1981; Die Tora in jüdischer Auslegung, Übersetzung und Bearbeitung von Annette Böckler, Einleitung von Walter Homolka, 5 Bände, Gütersloh 1999; München 42011.
Septuaginta
Die meisten Bücher der hebräisch-aramäischen Bibel wurden von 250 bis 100 vor Christus in Alexandria der Überlieferung nach von „siebzig“ (septuaginta) Übersetzern ins Griechische (Koinē) übertragen; die Übersetzung der restlichen Bücher folgte bis 100 nach Christus.
Die Bedeutung der Septuaginta liegt darin, daß damals Handschriften zur Verfügung standen, die heute verloren sind. Außerdem liegt der Übersetzung ein vormasoretischer Text zugrunde, der Zugang zur älteren hebräischen und aramäischen Sprachgestalt gewährt.
Textausgaben
· The Old Testament in Greek According
to the Septuagint, Henry Barclay Swete (1835-1917), 3 Bände,
Cambridge 1887; 1896; 1901; 1909; 1912; 1925; 1930.
· Septuaginta. Id est Vetus
Testamentum græce iuxta LXX interpretes, Otto
Gustav Alfred Rahls (1865-1935), 2 Bände, Stuttgart
1935; 1965.
· Septuaginta. Vetus Testamentum Græcum, Alfred Rahlfs, Rudolf Smend, Reinhard Gregor Kratz, Hermann Spieckermann, Robert Hanhart, Eduard Lohse, Reinhard Feldmeier, Ekkehard Mühlenberg und Heinz-Günther Nesselrath, 24 Bände, Göttingen 1931-2015. (Ein Drittel der Septuaginta wurde noch nicht kritisch herausgegeben.)
Übersetzung
und Kommentar
· Septuaginta deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung, Martin Karrer und Wolfgang Kraus, 2 Bände, Stuttgart 2009.
· Septuaginta deutsch. Erläuterungen und Kommentare zum griechischen Alten Testament, Martin Karrer und Wolfgang Kraus, 2 Bände, Stuttgart 2011.
Konkordanz
· A Concordance of the Septuagint and
the Other Greek Versions of the Old Testament (Including the Apocryphal Books),
Edwin Hatch und Henry A. Redpath, 3 Bände, Oxford
1897; Graz 1975.
Wörterbücher
· A Greek-English Lexicon of the
Septuagint, J. Lust, E. Eynikel, K. Hauspie und G.
Chamberlain, 2 Bände, Stuttgart 1992; 1994; 1996;
2003.
· A Greek-English Lexicon of the
Septuagint, Takamitsu Muraoka, Löwen 2009.
· Septuaginta-Vokabular, Friedrich Rehkopf, Göttingen 1989.
Grammatiken
· Selections from the Septuagint, F.
C. Conybeare und St. George Stock, Boston, Massachusetts 1905; A Grammar of
Septuagint Greek, Grand Rapids, Michigan 1980.
· A Grammar of the Old Testament in
Greek According to the Septuagint, Henry St. John Thackeray, Cambridge 1909;
Hildesheim, Zürich und New York 2003.
· Grammatik der Septuaginta. Laut- und Wortlehre, Robert Helbing, Göttingen 1907; 1979.
Septuaginta-Literatur
· Einleitung in die Septuaginta, Siegfried Kreuzer, Handbuch zur Septuaginta, Band 1, Gütersloh 2016.
· Die Septuaginta. Text, Wirkung, Rezeption, Wolfgang Kraus und Siegfried Kreuzer, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, Band 325, Tübingen 2014.
· Der historische und kulturelle Kontext der Septuaginta, Walter Ameling, Handbuch zur Septuaginta, Band 4, Gütersloh 2024.
· Die Theologie der Septuaginta, Hans Ausloos und Bénédicte Lemelijn, Handbuch zur Septuaginta, Band 5, Gütersloh 2020.
Hexapla
In sechs Versionen (hexapla – sechsfach) bot Origenes um das Jahr 245 den alttestamentlichen Text dar: in hebräischer Konsonantenschrift, in Umschrift durch griechische Buchstaben und in verschiedenen Versionen der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes: Aquila, Symmachos, Theodotion und in einer eigenen Rezension durch Origenes.
Die Bedeutung dieser Synopse liegt darin, daß Origenes Handschriften zur Verfügung hatte, die heute verloren sind. Außerdem überlieferte er die vormasoretische Aussprache des hebräischen Bibeltextes.
· Origenis Hexaplorum quæ supersunt sive Veterum interpretum græcorum in totum Vetus Testamentum fragmenta, Frederick Field (1801-1885), 2 Bände, Oxford 1875; Hildesheim 1964.
Deuterokanonisches und Pseudepigraphen
Einleitung
und Sammelbände
· Einleitung in die alttestamentlichen Apokryphen und Pseudepigraphen einschließlich der großen Qumran-Handschriften, Leonhard Rost, Heidelberg 1971; 1979; 1985.
· Altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel, Paul Rießler (1865-1935), Freiburg im Breisgau und Heidelberg 1928; 1966; 1975; 1979; 1980; 1984; 1988.
· Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, Emil Friedrich Kautzsch (1841-1910), 2 Bände, Tübingen 1898.1900; Hildesheim und New York 1975.
· Jüdische Schriften aus hellenistisch-jüdischer Zeit, Werner Georg Kümmel, Christian Habicht, Otto Kaiser, Otto Plöger und Josef Schreiner, 37 Bände, Gütersloh 1973-2003.
· Pseudepigrapha Veteris Testamentis Græce, herausgegeben von A. M. Denis, M. de Jonge, Sebastian Brock, Christoph Burchard und Johannes Tromp, 6 Bände, Leiden 1967-2024.
· The Apocrypha and Pseudepigrapha of the
Old Testament, Robert Henry Charles (1855-1931), 2 Bände,
Oxford 1913; 1963; 1965; 1966; 1968; 1971; 1973; 1976; 1977; 1978; 1979.
Deuterokanonische Schriften
· The Book of ben Sira in Hebrew. A
Text Edition of All Extant Hebrew Manuscripts and A Synopsis of All Parallel
Hebrew Ben Sira Texts, Pancratius C. Beentjes,
Supplements to Vetus Testamentum,
Band LXVIII, Leiden und New York 1997; 2003; Atlanta, Georgia 2006.
· Sapientia Iesu
Filii Sirach, Joseph Ziegler, Septuaginta. Vetus Testamentum Græcum,
Band 12/2, Göttingen 1965; 1980; 2016.
Pseudepigraphen
· Das sogenannte hebräische Henochbuch (3 Henoch) nach dem von Hugo Odeberg [Hugo Olsson; 1898-1973] vorgelegten Material übersetzt von Helmut Hofmann, Bonner biblische Beiträge, Band 58, Königstein im Taunus und Bonn 1984.
· The Ethiopic Version of the Book of
Enoch, Robert Henry Charles, Oxford 1906.
· The Ethiopic Version of the Book of
Jubilees, Robert Henry Charles, Oxford 1895.
· Die Oden Salomos. Griechisch – Koptisch – syrisch mit deutscher Übersetzung, Michael Lattke, Darmstadt 2011.
· Die Oden Salomos, Michael Lattke, Fontes Christiani, Band 19, Freiburg im Breisgau, Basel, Wien, Barcelona, Rom und New York 1995.
· Testamente der Zwölf Patriarchen, Robert Henry Charles, Oxford 1908.
Apokalyptik
Das griechische Wort ἀποκάλυψις (apokálypsis) bedeutet: Enthüllung (des Verborgenen), Offenbarung. In Zeiten der Bedrängnis erschienen vermehrt apokalyptische Schriften. Sie erzählten einerseits von schrecklichen Ereignissen, spendeten andererseits aber auch Trost, indem sie darauf hinwiesen, daß der Allmächtige dies alles souverän überwindet.
· Apokalyptik, Stefan Beyerle, Uni-Taschenbuch, Band 6258, Themen der Theologie, Band 15, Tübingen 2024.
· Apokalyptik, Klaus Koch und Johann Michael Schmidt, Wege der Forschung, Band 365, Darmstadt 1982.
· Apokalyptik, Michael Tilly, Uni-Taschenbuch, Band 3651, Profile, Tübingen 2012.
· Frühjüdische und urchristliche Apokalyptik. Eine Einführung, Ferdinand Hahn, Neukirchen-Vluyn 1998.
· Studien zur frühjüdischen Apokalyptik, Karlheinz Müller, Stuttgart 1991.
Messianismus
Die Erwartung eines kommenden Retters und Befreiers taucht mit den prophetischen Schriften auf. Vor allem die Erwartung des Wiederkehrenden Davids steht im Mittelpunkt.
· Alttestamentliche Christologie. Zur Geschichte der Messiasidee, Henri Cazelles (1912-2009), Einsiedeln 1983.
· The Septuagint and Messianism,
Michael A. Knibb, Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium, Band
195, Löwen 2006.
· Qumram Messianism. Studies on the
Messianic Expectations in the Dead Sea Scrolls, James H. Charlesworth, Tübingen
1998.
· Messianism in the Talmudic Era, Leo
Landman, New York 1979.
· Dieux dʼhommes.
Dictionnaire des messianismes et millénarismes de lʼère
chrétienne, Henri Desroche (1914-1994), Paris 1969.
· Jewish Messianism in the Early
Modern World, Matt D. Goldish und Richard H. Popkin, Dordrecht 2001.
Schabbtaj Zvi
Er wurde 1626 in Smyrna geboren, beschäftigte sich bereits in seiner Jugend mit der Kabbala und begann ein asketisches Leben. Er hatte ein sanguinisch-melancholisches Temperament. Zur Zeit des Pogroms 1648 in Osteuropa hatte Schabbtaj eine Berufungsvision: Er sah sich als Prophet. Drei oder sechs Jahre später wurde er aus seiner Gemeinde in Smyrna ausgeschlossen und ging nach Saloniki. Nachdem er dort eine Torarolle unter einem Hochzeitsbaldachin symbolisch geehelicht hatte, wurde er auch dort ausgeschlossen und lebte danach in verschiedenen griechischen Städten. 1658 war er in Konstantinopel, studierte dort die Kabbala, wurde 1659 auch hier ausgeschlossen und kehrte nach Smyrna zurück. 1665 erklärte er sich als Messias. 1666 konvertierte er zum Islam. Er starb am 16. September 1676 in Ülgün, heute Montenegro.
· Sabbatai Zewi. Der Messias von Ismir, Josef Kastein (Julius Katzenstein; 1890-1946), Berlin 1930.
· Sabbatai Zwi. Der mystische Messias, Gershom Scholem, Frankfurt am Main 1992.
Philo von Alexandrien
·
Colson,
F. H., und Ralph Marcus, 10 Bände und 2 Ergänzungsbände, The Loeb Classical Library, London und
Cambridge, Massachusetts 1941; 1954; 1960; 1967; 1981; 1985; 1994.
· Opera qvæ svpersvnt, Leopold Cohn (1856-1915), und Paul Wendland, 7 Bände, Berlin 1896-1906.
· Die Werke in deutscher Übersetzung, Leopold Cohn, Isaac Heinemann, Maximilian Adler und Willy Theiler, 7 Bände, Berlin 21962-1964.
Geniza
Das hebräische Wort גניזה genīzā – Begräbnis, Aufbewahrung, Lager, Depot, Schatzkammer, Speicher
bezeichnet einen Aufbewahrungsort für unbrauchbar gewordene religiöse
Schriften. Die bekannteste Geniza befindet sich in der Ben-Ezra-Synagoge in
Kairo, aber es gibt solche Orte auch in anderen Ländern.
Kairoer Geniza: Texte
· Magische Texte aus der Kairoer Geniza, Peter Schäfer, Shaul Shaked und Reimund Leicht, 3 Bände, Texte und Studien zum antiken Judentum, Band 42.64.72, Tübingen 1994.1997.1999.
· The Book of Ben Sira in Hebrew. Text
Edition of All Extant Hebrew Manuscripts and A Synopsis of All Parallel Hebrew
Ben Sira Texts, Pancratius C. Beentjes, Supplements
to Vetus Testamentum,
Atlanta 2006.
· Text und Textform im hebräischen Sirach. Untersuchungen zur Textgeschichte und Textkritik der hebräischen Sirachfragmente aus der Kairoer Geniza, Hans Peter Rüger, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Band 112, Berlin 1970.
· Die Weisheitsschrift aus der Kairoer Geniza. Text, Übersetzung und philologischer Kommentar, Hans Peter Rüger, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, Band 53, Tübingen 1991.
· Text und Sprache der hebräischen Weisheitsschrift aus der Kairoer Geniza, G. Wilhelm Nebe, Heidelberger Orientalistische Studien, Band 25, Frankfurt am Main 1993.
· Geniza-Fragmente zur Hekhalot-Literatur, Peter Schäfer, Texte und Studien zum antiken Judentum, Band 6, Tübingen 1984.
· Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zu den Texten vom Toten Meer einschließlich der Manuskripte aus der Kairoer Geniza, Reinhard Gregor Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper, Berlin und Boston 2017f. (Bisher erschienen: Buchstaben Aleph bis Zajin; insgesamt zwei Bände.)
· A Grammar of Early Judaeo-Persian.
Grammatical and Philological Studies on the Early Judaeo-Persian Texts from the
Cairo Geniza, Paul Ludwig, Habilitationsschrift, Göttingen 2002; Wiesbaden
2013.
Kairoer Geniza: Literatur
· A Jewish Archive from the Old Cairo,
Stefan C. Reif, Richmond (Surrey, London) 2000.
· Cairo Geniza, Paul Eric Kahle (1875-1964), The Schweich Lectures of the British Academy, London 1941; London 1947; Oxford 1959; Die Kairoer Genisa. Untersuchungen zur Geschichte des hebräischen Bibeltextes und seiner Übersetzungen, Übersetzung und Bearbeitung von Rudolf Meyer, Berlin 1962.
· Documents of the Jewish Pious
Foundations from the Cairo Geniza, Moshe Gil, Leiden 1976.
· Египетские древности в Российской национальной библиотеке (Ägyptische
Altertümer in der Russischen
Nationalbibliothek St. Petersburg), Olʼga
Valentinovna Vasilʼeva, St. Petersburg 2023.
· Genizah Research After Ninety Years.
The Case of Judaeo-Arabic, Joshua Blau und Stefan C. Reif, Cambridge 1992.
· Sacred Trash. The Lost and Found
World of the Cairo Geniza, Adina Hoffman und Peter Cole, New York 2011.
· The Cambridge Geniza Collections.
Their Contents and Significance, Stefan C und Shulamit Reif, Cambridge 2002.
Genizafunde in Deutschland
Wegen ihrer versteckten Lage haben Genizatexte häufig die Zerstörung der jeweiligen Synagoge überlebt. Sie sind daher meist der einzige erhaltene schriftliche Beleg für das Leben der Gemeinde.
In Deutschland gibt es Genizafunde in Allersheim, Alsenz, Altenkunstadt, Altenschönbach, Bayreuth, Biberach an der Riß, Bruttig, Cronheim, Ediger, Freudental, Gaukönigshofen, Goßmannsdorf, Kleinsteinach, Lichtenfels, Mainz-Weisenau, Memmelsdorf, Niederzissen, Obernbreit, Reckendorf, Urspringen, Veitshöchheim, Weisenau, Wiesbaden-Delkenheim und Wiesenbronn, also vor allem in Franken, Hessen und Rheinland-Pfalz.
· Die Genisot als Geschichtsquelle, Frowald G. Hüttenmeister, in: Jüdisches Leben auf dem Lande, herausgegeben von Monika Richarz und Reinhard Rürup, Tübingen 1997, 207-218.
· Genisa. Fundorte jüdischer Buchreste auf Dachböden und in Bucheinbänden, Andreas Lehnardt, in: Biographien des Buches, herausgegeben von Ulrike Gleixner, Constanze Baum, Jörn Münkner und Hole Rößner, Kultur des Sammelns, Band 1, Göttingen 2017.
· Genisa. Verborgenes Erbe der deutschen Landjuden, Falk Wiesemann, Ausstellung in London, Gütersloh und München 1992.
· Genisot. Funde aus Synagogen, Martina Edelmann, Elisabeth Singer-Brehm und Beate Weinhold, in: Museumsbausteine. Jüdisches Kulturgut erkennen, bewahren, vermitteln, herausgegeben von Otto Lohr und Bernhard Purin, Berlin und München 2017, 97-110.
· Moderne Genisaforschung in Deutschland, Elisabeth Singer-Brehm, in: Aschkenas 32 (2022), 429-463.
Andere Genizafunde in Europa
Im angezeigten Werk werden Genizafunde besprochen, aus Italien (Bologna, Innichen, Lugo di Romagna, Otranto, Padua, Rom, San Marino und Urbino), Frankreich (Arras, 50 km südwestlich von Lille, sowie aus der Provence), aus der Schweiz und aus Spanien.
· „Habent sua fata fragmenta“. Festschrift für Mauro Perani, herausgegeben von Emma Abate, Saverio Campanini, Judith Olszowy-Schlanger und Giuseppe Veltri, Studies in Jewish History and Culture, Band 76, European Geniza. Texts and Studies, Band 7, Leiden und Boston 2025.
Genizafunde der Provinz Chorasan
· Жизнь в средневековом Хорасане. Гениза из Национальной библиотеке Израиля (Leben im mittelalterlichen Chorasan. Eine Geniza aus der Nationalbibliothek Israels), Ausstellung in der Eremitage St. Petersburg, Michail Borisovič Piotrovskij und Anton Dmitrievič Pritula, Übersetzung von David Hicks, St. Petersburg 2019.
Exegese
Ibn Ezra
Abraham ben Meir ibn Ezra (um 1092-1167) war ein Vorreiter wissenschaftlicher Bibelauslegung, weswegen er mit der jüdischen Gemeinde in Rom Schwierigkeiten bekam. Er lebte in Spanien, Italien, Frankreich und England, machte aber auch Reisen nach Nordafrika.
· Ibn Ezraʼs Commentary on the Pentateuch, Übersetzung und Anmerkungen von H. Norman Strickman und Arthur M. Silver, 6 Bände, New York 1988-2004.
· The Commentary of ibn Ezra on
Isaiah, Michael Friedländer, 3 Bände, London 1874;
New York 1964.
· Abraham ibn Ezraʼs Commentary
to the Minor Prophets. Vatican Manuscript Vat. Ebr.
75, Etan Levine, Jerusalem 1976.
Raschi
Rabbi Schlomo Jizchaki (Raschi; 1040/1041-1105, Geburt und Tod in Troyes) war ein französischer Tora- und Talmud-Kommentator.
· Raschi. Der Kommentar des Salomo b. Isak über den Pentateuch, herausgegeben von Abraham Berliner (1833-1915), Berlin 1903; Frankfurt 21905; Jerusalem 1969; Hildesheim, Zürich und New York 1999.
· Raschis Pentateuchkommentar, Übersetzung und Einleitung von Selig Pinchas haLevi Bamberger (1872-1936), Basel 2002.
Biblisch-hebräische
Dichtung
· Hebrew Poetry in the Bible. A Guide
for Understanding and for Translating, Lynell Zogbo und Ernst R. Wendland,
Helps for Translators, New York 2000.
· The Poems and Psalms of the Hebrew
Bible, Susan E. Gillingham, Oxford Bible Series, Oxford 1994.
· Word-order Variation in Biblical
Hebrew Poetry, Nicholas P. Lunn, Paternoster Biblical Monographs, Dissertation,
London 2004; Bletchley, Buckinghamshire 2006.
Bibellexika
und Handbuch zur Bibel
· Bibel-Lexikon, Herbert Haag (1915-2001), Einsiedeln 1951; 1968; Leipzig 1973; 1981; Zürich 1982.
· Biblisch-historisches Handwörterbuch. Landeskunde ˑ Geschichte ˑ Religion ˑKultur ˑ Literatur, Bo Ivar Reicke (1914-1997) und Leonhard Rost (1896-1979), 4 Bände, Göttingen 1962; 1979; 1994.
· Calwer Bibellexikon, Otto Betz, Beate Ego, Werner Grimm und Wolfgang Zwickel, Stuttgart 2003.
· Das große Handbuch zur Bibel, Pat und David Alexander, Wuppertal, Stuttgart und Innsbruck 2001.
· Archäologisches Lexikon zur Bibel, Avraham Negev (1923-2004) und Joachim Rehork, München, Wien und Zürich 1972.
Bibelatlanten
· Herders neuer Bibelatlas, Wolfgang Zwickel, Renate Egger-Wenzel, Michael Ernst und Franz Kogler, Freiburg im Breisgau, Zürich und Wien 2013; 2023.
· Historisch-geographischer Atlas zur Bibel, Carl G. Rasmussen, Neuhausen 32002.
· The Macmillan Bible Atlas, Yohanan Aharoni (1919-1976) und Michael Avi-Yonah, Jerusalem 1968; New York 1977; 1993; Der Bibelatlas. Die Geschichte des Heiligen Landes, 3000 Jahre vor Christus bis 200 Jahre nach Christus, Übersetzung von Walter Hertenstein, Bearbeitung von Joachim Rehork, Hamburg 1981; Augsburg 1998.
· The Essential Atlas of the Bible, Marcus Braybrooke, James Harpur und Felicity Cobbing, London 1998; 1999; Der große Bibel-Atlas, Übersetzung von Gina Beitscher, Hermann Ehmann, Matthias Flender, Peter Knecht, Renate Rosenthal-Heginbottom und Stefan Schreiber, Redaktion von Anja Halveland, Christiane Burkhardt, Petra Gulz und Bernd Mayerhofer, wissenschaftliche Beratung durch Jürgen Werlitz, München 2005.
· The Times Atlas of the Bible, James Bennett Pritchard (1909-1997), London 1987; Herders großer Bibelatlas, Übersetzung von Annemarie Ohler, A. Nancy Berner und Georg Gnandt, Register von Wolfgang Litzba, herausgegeben von Othmar Keel und Max Küchler, Freiburg im Breisgau, Basel und Wien 1989.
Ikonographie
zum Alten Testament
· Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testament, Hugo Greßmann, Arthur Ungnad und Hermann Ranke, Band 2: Bilder, Tübingen 1909; Berlin 1927; 1970.
· Die Ikonographie Palästinas/Israels und der Alte Orient. Eine Religionsgeschichte in Bildern, Silvia Schroer und Othmar Keel, 4 Bände, Freiburg im Üechtland 2005.2008.2011.2018.
· Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament am Beispiel der Psalmen, Othmar Keel, Zürich, Köln und Neukirchen-Vluyn 1972; 1977; 1980; 1984; Göttingen 1996; 1997; 2021.
· The Ancient Near East in Pictures
Relating to the Old Testament, James Bennett Pritchard, Princeton, New Jersey
und London 1954; 1974.
· Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole, Manfred Lurker, München 1973; 1978; 1987; 1990.
Biblische
Kulturgeschichte
· Grab, Sarg-, Bau- und Votivinschriften, Daniel Arpagaus, Burkhard Backer, Angelika Berlejung, Louise Gestermann, Karl Hecker, Hanna Jenni, Andrea Jörgens, Jörg Klinger, Heidemarie Koch, Ingo Kottsieper, Steven Lundström, Matthias Müller, Walter W. Müller, Anne Multhoff, Norbert Nebes, Hans Neumann, Herbert Niehr, Susanne Paulus, Carsten Peust, Daniel Schwemer, Peter Stein, Günter Wittmann und Annick Wüthrich, Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Neue Folge, Band 6, Gütersloh 2011.
· Omina, Orakel, Rituale und Beschwörungen, Annette Krüger, Tzvi Abusch, Karl Hecker, Andrea Jördens, Jörg Klinger, Heidemarie Koch, Matthias Müller, Anne Multhoff, Hans Neumann, Herbert Noehr, Carsten Peust, Rosel Pientka-Hinz, Joachim F. Quack, Miriam-Rebecca Rose, Daniel Schwemer und Peter Stein, Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Neue Folge, Band 4, Gütersloh 2008.
· Einleitung in das Alte Testament, Erich Zenger (1939-2010), Christian Frevel und Heinz-Josef Fabry, Stuttgart 92016.
· Die Pharisäer, Leo Baeck, Berlin 1934.
· The Pharisees, Joseph Sievers, Amy Jill-Levine und Jens Schröter, Chicago 2021; Die Pharisäer. Geschichte und Bedeutung, Übersetzung von Claus-Jürgen Thornton, Freiburg im Breisgau, Basel und Wien 2024.
· Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament, Walter Beyerlin, Hellmut Brunner, Hartmut Schmökel, Cord Kühne, Karl-Heinz Bernhardt und Edward Lipiński, Grundrisse zum Alten Testament, Band 1, Göttingen 1975.
· Arbeit und Sitte in Palästina, Gustaf Dalman, 7 Bände, Schriften des Deutschen Palästina-Instituts, Band 3-10, Gütersloh 1928-1942; Hildesheim, Zürich und New York 1987.
· Edelsteine in der Bibel, Wolfgang Zwickel, Ausstellungen in Frankfurt am Main, Meersburg und Stuttgart, Mainz 2002.
· Musik in biblischer Zeit und orientalisches Musikerbe, Thomas Staubli, Andreas Marti, Silvia Schroer und Dahlia Shehata, Bibel und Orient, Freiburg im Üechtland 2007.
· Die Moabiter – Geschichte und Kultur eines ostjordanischen Volkes im 1. Jahrtausend v. Chr., Erasmus Gaß, Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins, Band 38, Wiesbaden 2009.
· Namen und Orte der Bibel, Hellmut Haug, Stefan Sigloch und Karl Fröschle, Bibelwissen, Stuttgart 1981; 2001; 2002.
· Wer ist wer in der Bibel? Personenlexikon zum Buch der Bücher. Mehr als 3.500 Namen, Anja Clauberg, Rudolf-Brockhaus-Taschenbuch, Band 721, Wuppertal, 1996; 1998; 2001; 2002; 2009; 2010; 2013; 2014.
· Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testament, Hugo Greßmann, Arthur Ungnad und Hermann Ranke, Band 1: Texte, Tübingen 1909; Berlin 1926; mit Erich Ebeling, Berlin 1965; 1970.
· Textbuch zur Geschichte Israels, Kurt Galling, Elmar Edel und Eugen L. Rapp, Tübingen 1950.
· Ancient Near Eastern Texts Relating
to the Old Testament, James Bennett Pritchard, Princeton, New Jersey und London
1950; 1955; 1974; 1992.
· Historisches Textbuch zum Alten Testament, Manfred Weippert, Joachim Friedrich Quack, Bernd Ulrich Schipper und Stefan Jakob Wimmer, Grundrisse zum Alten Testament, Band 10, Göttingen 2010.
Midrasch
Ein Midrasch ist eine Bibelauslegung. Es geht darum, das jeweilige Wort der Heiligen Schrift für die Gegenwart verständlich zu erklären, Weisung für das Tun und die Lebensgestaltung zu erhalten sowie Trost und Stärkung zu finden.
· Midrasch rabba, Moše Arie Mirkin und Y. Orenstein, 11 Bände, Tel Aviv 1956-1968.
· Midrasch rabba, 2 Bände, Jerusalem 1970.
· Eine Sammlung alter Midraschim, Karl August Wünsche (1838-1912), F. Fürst, Julius Fürst, O. Straschun und M. Grünwald, 12 Bände, Bibliotheca Rabbinica, Leipzig 1880-1885; Hildesheim, Zürich, New York und Vaduz 1993. Midrasch rabba: Bereschit (Gen). Schemot (Ex). Wajikra (Lev). Bemidbar (Num). Debarim (Dtn). Esther. Ruth. Echa (Klagelieder). Mischle (Spr). Kohelet. Schir haSchirim (Hld). Außerdem: Pesikta Rab Kahana.
· Midrasch šōḥār ṭōv (gute Erleuchtung), Lemberg 1861 (Midrasch zu den Sprichwörtern und zu den Samuelbüchern).
· Tannaitische Midraschim, Karl Georg Kuhn, Henrik Ljungman und Dagmar Börner-Klein; 12 Bände, Stuttgart 1933; Rabbinische Texte, Stuttgart 1997.
· Einleitung in Talmud und Midraš, Hermann Lebrecht Strack (1846-1922), München 1921; Einleitung in Talmud und Midrasch, München 1930; 1961; Günter Stemberger, Becksche Elementarbücher, München 1976; C. H. Beck-Studium, München 1982; 1992; 2011.
Mischna
Die Mischna ist die „Wiederholung“, eine halachische (gesetzliche) Auslegung der Heiligen Schrift. Im Aramäischen sind die Tannaiten die „Wiederholer“, weil die Lehre durch ständige Wiederholung eingeprägt wurde. Das hebräische šnh entspricht dem aramäischen tnʼ oder tny – wiederholen, wörtlich: ein „zweites Mal“ sagen.
· Mischnajot. Die sechs Ordnungen der Mischna, David Hoffmann und Ascher Sammter, 6 Bände, Berlin 1887-1927; Wiesbaden 1933; Basel 1968; 1986.
· Die Mischna. Textkritische Ausgabe mit deutscher Übersetzung und Kommentar, Michael Krupp, 6 Bände, Jerusalem 2002-2006; Frankfurt am Main 2007-2017.
Tosefta
Die Tosefta (Hinzufügung, Ergänzung) steht zwischen Mischna und Talmud. Sie entstammt dem dritten nachchristlichen Jahrhundert und wird Chija bar Abba I. zugeschrieben.
· DieTosefta, Rabbinische Texte, Gerhard Kittel und Karl Heinrich Rengstorf, 19 Lieferungen, Stuttgart 1952-1965.
· Der Toseftatraktat Jom hak-Kippurim. Text, Übersetzung, Kommentar, Göran Larsson, Dissertation, Lund 1980. (Nur der erste Teil mit den Kapiteln 1 und 2 ist erschienen.)
Talmud
Der Grundbestand des Talmuds (Lernen, Lehre) ist die Mischna. Daran angefügt ist die Gemara, die Vollendung. Der Talmud ist ein unerschöpfliches Buch. Er enthält Weisungen, Lehre, Diskussionen, Bibelauslegung, Erzählungen, Rätsel, ja sogar humoristische Fragen und Anekdoten. Dabei ist seine Form äußerst knapp. Es gehört ein ausführliches Studium dazu, ihn richtig aufzufassen, das Wichtigste zu behalten und im eigenen Leben sowie in der Gemeinde zu verwirklichen.
Babylonischer
Talmud
· Talmūd Bavlī, Daniel Bomberg, 12 Bände, Venedig 1529-1533; 37 Bände, Wilna 1835; 1875-1883; 20 Bände, Jerusalem o. J.
· Der Babylonische Talmud, Lazarus Goldschmidt Elieser ben Gabriel; 1871-1950), 12 Bände, Berlin 1897-1909; Berlin 1929-1936; 1967; Frankfurt am Main 1996; 2002; 2007.
· Bibelstellenregister zum Babylonischen Talmud nach der Übersetzung von Lazarus Goldschmidt, ergänzt um Belegstellen aus Qumrantexten, García Martinez und Eibert J. C. Tigchelaar, Keltern (Enzkreis, Baden-Württemberg) 2014.
Jerusalemer
Talmud
· Talmūd Yerušalmī, Daniel Bomberg, 4 Bände, Venedig 1523; Wilna 1922; Jerusalem o. J.
· Übersetzung des Talmud Yerushalmi, herausgegeben von Martin Hengel, Jacob Neusner, Friedrich Avemaria, Hans-Jürgen Becker, Frowald Gil Hüttenmeister, Charles Horowitz, Heinz-Peter Tilly, Peter Schäfer, Andreas Lehnardt, Vladislav Slepoj und Gerd A. Wewers, 34 Bände, Tübingen 1975-2016.
Literatur
zum Talmud
· Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Ernst Friedrich Paul Billerbeck, 4 Bände, München 1922.1924.1926.1928; 1956; 1961; 1965; 1969; 1974f; 1982f; 1985f; 1994; Rabbinischer Index. Verzeichnis der Schriftgelehrten. Geographisches Register, herausgegeben von Joachim Jeremias in Verbindung mit Kurt Adolph, Band 5, München 1956; Band 6, München 1961; Band 5 und 6 in einem Buch, München 1974. Hermann Lebrecht Strack, der als Herausgeber angeführt wird, hat lediglich seinen Namen hergegeben, um das Werk bekanntzumachen.
· Einleitung in den Thalmud, Hermann Lebrecht Strack, Leipzig 1887; 1894; Institutum Judaicum (Berlin), Schriften, Band 2, Leipzig 1908; Einleitung in Talmud und Midraš, München 1921; Einleitung in Talmud und Midrasch, München 1930; 1961; Günter Stemberger, Becksche Elementarbücher, München 1976; Beck-Studium, München 1982; 1992; 2011.
· Talmud-Lexikon, Zadoq ben Ahron, Köln und Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) 2006.
Targum
Das Targum (Übersetzung) ist die Übertragung der hebräischen Heiligen Schrift ins Aramäische. Stellenweise werden dabei auch midraschartige Auslegungen gegeben.
· Chaldäisches Lehrbuch aus den Targumim des Alten Testaments, Georg Benedict Winer und Julius Fürst, Leipzig 21804.
· The Bible in Aramaic, Based on Old
Manuscripts and Printed Texts, Alexander Sperber, 4 Bände
in 5 Büchern, Leiden 1959.1962.1968.1973.
Haggada
Die Haggada (Erzählung) wird am Vorabend des Pesachfestes vorgelesen. Der Jüngste fragt: „Warum ist diese Nacht unterschieden von allen anderen Nächten?“ Daraufhin wird die Befreiung des Volkes Israel aus ägyptischer Fron dargelegt. – Der Text entstand um 1350 in Spanien.
Die Amoräer (die Berichtenden) waren palästinensische und babylonische Gelehrte des 3. bis 5. Jahrhunderts, die das Gesetz „erzählt“ haben. Ihre Überlieferung wird Haggada genannt, im Gegensatz zur Halacha, der Gesetzesauslegung.
Pesach-Haggada
· Die Pessach-Hagadah, Herzlia 2003.
· Hagadah schel Peßach, M. Lehmann, Frankfurt am Main 1903; Basel 1962.
Pesiqda
Pesiqda bedeutet: Abschnitt. Es handelt sich um den Lesungsabschnitt des jeweiligen Sabbats. Dies ist die älteste Predigtsammlung zu ausgewählten Sabbaten (Tora- oder Prophetenlesung). Sie stammt aus dem Palästina des 5. Jahrhunderts. Rabbi Kahana (4. Jahrhundert) wird zu Beginn genannt, ist aber nicht der Verfasser dieses Werkes.
· Pesiqda de rav Kahana, herausgegeben von Salomon Buber (1827-1906) und Bernard Mandelbaum, 2 Bände, Lyck 1868; Wilna 1925; New York 1962; 1987; Jerusalem o. J.
Halacha der
Amoräer
· Die Agada der babylonischen Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte der Agada und zur Einleitung in den babylonischen Talmud, Wilhelm Benjamin Seʼew (zeʼev – Wolf) Bacher (1850-1913), Straßburg 1878; Frankfurt am Main 1913; Hildesheim, Zürich und New York 1967.
· Die Agada der palästinensischen Amoräer, Wilhelm Benjamin Seʼew Bacher, 3 Bände, Straßburg 1892.1896.1899; Hildesheim, Zürich und New York 1992.
· Die Agada der Tannaiten, Wilhelm Benjamin Seʼew Bacher, 2 Bände, Straßburg 1884.1890; 1903; Berlin 1965f.
Periodisierung: Tannaiten
Periodisierung: Amoräer
Halacha
Halacha bedeutet: Lebenswandel und weist auf das Ziel seiner Regelung hin. Der Begriff kommt vom hebräischen הלך haláḵ – gehen, wandeln. Es geht darum die Lebensführung nach den 613 Geboten und Verboten auszurichten.
· Schulchan Aruch (šulḥān ʿarūḥ – gedeckter Tisch), Josef Karo (1488-1575), 9 Bände, Jerusalem 1992.1994.1996.1999-2004; 2011-2017. Dieses Werk legt die Gesetze und Verbote des Tanachs und des Talmuds dar und beschränkt sich dabei auf häufig vorkommende Fälle.
· Schulchan Aruch, Michael Creizenach, 4 Bände, Frankfurt am Main 1833.
· Kizzur Schulchan Aruch, Solomo ben Joseph Ganzfried (1804-1886), Wilna 1864; 1900; Übersetzung und Vokalisierung von Selig Pinchas haLevi Bamberger, 2 Bände, Frankfurt am Main 1930; Basel 1957; 1964; 1978; 1988; 2016.
Chasidim
Chasidim (ḥasidīm) sind die Frommen. Die Bewegung des Chasidismus entstand im 18. Jahrhundert in Osteuropa. Um einen Zadík (ṣaddīq – Gerechter) scharen sich Jünger, die er unterweist. Oft zeichnet er sich durch die Gabe der Heilung und der Prophetie aus.
Quellen des
Chasidismus
· Die Geschichten vom Baʽal Schem Tov. Schivche ha-Bescht, Karl E. Grözinger, Ruth Berger, Uli Faber, Veronika Lipphardt, Sigrid Senkbeil und Rachel Elior, Jüdische Kultur, Band 2, 2 Bände, Wiesbaden 1997.
· Die Erzählungen der Chassidim, Martin Mordechai Buber, Zürich 1949; 2014. Der Nachteil dieses weitverbreiteten Werkes ist, daß Buber alle halachischen Texte und Äußerungen der von ihm zitierten Personen wegließ, da er die Halacha als überholt ansah.
· Die Geschichten des Rabbi Nachman, Martin Mordechai Buber, Frankfurt am Main 1906.
· Die Legende des Baalschem, Martin Mordechai Buber, Frankfurt am Main 1906.
Geschichte
des Chasidismus
· Geschichte des Chassidismus, Simon (Semjon Markowitsch) Dubnow (1860-1941), 2 Bände, Berlin 1931.
· Hasidism. A New History, David
Biale, David Asaf und Martin Wodzinski, Princeton, New Jersey 2018.
Kabbala und jüdische Mystik
Die Kabbala (Überlieferung) entstand im Mittelalter. Es geht um eine unmittelbare Beziehung zum Lebendigen und Leben Schaffenden. Der Zohar (Abglanz des Lebendigen) entstand im mittelalterlichen Spanien.
Die Kabbala beschäftigt sich mit der Auslegung der hebräischen Buchstaben, mit dem Lebensbaum (Sephirōṯ), mit dem Tempel, dem Thronwagen und der Bindung Isaaks.
Das sumerische Wort e2-gal bedeutet: Haus-groß und bezeichnet den Palast. Im
Hebräischen ist hēḵál der Tempel oder der Palast. Es
geht darum, die himmlischen Paläste zu durchschreiten, um zum
Throne des Lebendigen zu gelangen.
Der
Prophet Ezechiel (Hesekiel) beschreibt im ersten Kapitel seines Buches (Verse
15-21) den Thronwagen (merkābā). Dieser
steht für den Lebendigen selbst.
Im
Buche Genesis (Erstes Buch Moses) wird im 22. Kapitel, Vers 9, erwähnt, daß
Abraham seinen Sohn Isaak band, um
ihn auf dem Altar, den er gebaut hatte, zum Opfer darzubringen. Diese Bindung (ʿaqedāh) ist Gegenstand mystischer Betrachtungen.
„Was muß Isaak in diesen schrecklichen Sekunden durchgemacht haben?“, fragte
Sören Kierkegaard. War er danach ein gebrochener Mensch? Verfolgte, Vertriebene
und Mißhandelte aller Zeiten konnten sich in dieser Bindung unschwer
wiedererkennen.
· The Zohar, Rav Shimon bar Yochai, Rav Yehuda Ashlag und Michael Berg, 23 Bände, New York 2003.
· The Zohar, Daniel C. Matt, Pritzker
Edition, 12 Bände, Stanford, California 2004-2017.
·
Das Buch Bahir. Ein Schriftdenkmal aus der
Frühzeit der Kabbala, Gershom Scholem, Dissertation, München 1922; Leipzig
1923; herausgegeben von Robert Osten, Hamburg 2008; 2016.
·
Shaʿarē ʼōrāh
(Tore des Lichtes), Joseph ben Abraham Gikatilla (1293), Riva di Trento 1559; Mantua 1561; Krakau
1600; Offenbach 1715; Warschau 1876; Jerusalem 1970; herausgegeben von Joseph
Ben Shlomo, 2 Bände, Jerusalem 1996.
· Die Kabbala von Papus (Gérard Encausse), Übersetzung von Julius Nestler, Leipzig 1910; 1921; 1932; Wiesbaden 1981; 1983; 1986; 1996; 1998; 2004.
· Kabbala denvdata sev Doctrina Hebræorvm transcendentalis et metyphysica atqve theologica. Opvs antiqvissimæ philosophiæ barbaricæ, Christian Knorr von Rosenroth (1636-1689), 2 Bände in 4 Büchern, Sulzbach und Frankfurt am Main 1677-1684.
·
Von der mystischen Gestalt der Gottheit. Studien
zu Grundbegriffen der Kabbala, Gershom Scholem, Zürich 1962; Suhrkamp
Taschenbücher Wissenschaft, Nr. 209, Frankfurt am Main 1973; 1977; 1986; 1991;
1995; 2015.
·
Alchemie und Kabbala, Gershom Scholem, in: Eranos-Jahrbuch 46 (1977), Frankfurt am Main 1981, 1-96.
·
Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen,
Gershom Scholem, Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, Band 330, Frankfurt am Main
1980.
·
Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Gershom Scholem,
Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, Band 13, Frankfurt am Main 1973.
· Die mystische Gestalt der Gottheit in der Kabbala, Gershom Scholem, in: Eranos-Jahrbuch XXIX (1960), Zürich 1961, 139-182.
· The Origins of Jewish Mysticism, Peter Schäfer, Tübingen 2009; Die Ursprünge der jüdischen Mystik, Übersetzung von Claus-Jürgen Thornton, Berlin 2011.
· Gut und Böse in der Kabbala, Gershom Scholem, in: Eranos-Jahrbuch XXX (1961), Zürich 1962, , 29-67.
· Zur Entwicklungsgeschichte der Kabbalistischen Konzeption der Schechinah, Gershom Scholem, in: Eranos-Jahrbuch XXI (1952), Zürich 1953, 45-107.
· De arte cabalistica libri tres. Die Kabbalistik, Johannes Reuchlin, Hebräischer Text herausgegeben von Reimund Leicht, herausgegeben von Widu-Wolfgang Ehlers und Fritz Felgentreu, Sämtliche Werke, Band II, 1, Stuttgart - Bad Cannstatt 2010.
· Die Kabbalah. Einführung ˑ Klassische Texte ˑ Erläuterungen, Johann Maier, München 1995; 2004.
· Vom Kultus zur Gnosis. Studien zur Vor- und Frühgeschichte der jüdischen Gnosis. Bundeslade, Gottesthron und Märkābā, Johann Maier, Kairos, Band 1, Salzburg 1964.
· Lebensbaum und Kabbala, Z’ev ben Shimon haLevi, München 1997.
· Übersetzung der Hekhalot-Literatur, Peter Schäfer, Klaus Herrmann, Ulrike Hirschfelder und Gerold Necker, 4 Bände, Texte und Studien zum antiken Judentum, Band 17.22.29.46, Tübingen 1987.1989. 1991.1995; Register, Tübingen 2008.
· Synopse zur Hekhalot-Literatur, Peter Schäfer, Texte und Studien zum antiken Judentum, Band 2, Tübingen 1981.
· Der verborgene und offenbarte Gott. Hauptthemen der frühen jüdischen Mystik, Peter Schäfer, Tübingen 1991.
· Die Entwickelung der Emanationslehre in der Kabbala des XIII. Jahrhunderts, Marcus Ehrenpreis, Frankfurt am Main 1895.
· Die Aqedat Jishaq. Die mittelalterliche jüdische Auslegung von Genesis 22 in ihren Hauptlinien, Rolf-Peter Schmitz, Dissertation, Köln 1976; Hildesheim 1979.
Isaak Luria (Yiṣḥaq ben Šlōmō Lūrīyā ʾAškenāzī
Sein Akronym ist Ari, der aschkenasische Rabbi Isaak.
Er wurde 1534 in Jerusalem geboren, begründete in Safed
(Galiläa) eine neue kabbalistische Schule und starb dort am 5. August 1572.
Sein Vater stammte aus Polen oder Deutschland und seine Mutter war sephardisch.
Sepharden sind Juden, die sich nach ihrer Vertreibung aus Spanien oder Portugal im Osmanischen Reich oder in Nordafrika niederließen. Auch ihre Nachkommen werden so bezeichnet. Obd 20 wird die Landschaft Sepharad genannt. Im Mittelalter wurde die Bezeichnung Sepharden auf Juden und ihre Nachkommen übertragen, die auf der Iberischen Halbinsel lebten.
Jer 51, 27 wird das Königreich Aschkenas genannt. Die Bezeichnung Aschkenasen wurde später auf deutsche Juden übertragen und danach als Bezeichnung nord-, mittel- und osteuropäischer Juden ausgeweitet.
· Einführung in die Lurianische Kabbala, Gerold Necker, Frankfurt am Main und Leipzig 2008.
· Physician of the Soul, Healer of the
Cosmos. Isaac Luria and His Kabbalistic Fellowship, Lawrence Fine, Stanford,
California 2003.
· Safed Spirituality. Rules of
Mystical Piety, The Beginning of Wisdom, Lawrence Fine und Louis Jacobs,
Mahwah, New Jersey 1984.
· The Tree of Life. Chayyim Vitalʼs
Introduction to the Kabbalah of Isaac Luria, herausgegeben
von Donald Wilder Menzi, Northvale, New Jersey 1998. Ḥayim ben Yosef Vital (1542-1620).
Sefer Jezira
Dieses „Buch der Formung/Schöpfung“, entstanden zwischen dem dritten und sechsten Jahrhundert nach Christus in Palästina und beschreibt die Entstehung der Welt (Kosmogonie) aus den hebräischen Buchstaben.
· Das Buch Jezira, Johann Friedrich von Meyer, Eveline Goodman-Thau, Christoph Schulte, Moshe Idel und Wilhelm Schmidt-Biggemann, Jüdische Quellen, Band 1, Berlin 1993.
Gebetbücher und Gottesdienst
· Gebetbuch für das Laubhüttenfest, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.
· Gebetbuch für das Neujahrsfest, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.
· Gebetbuch für das Pessachfest, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.
· Gebetbuch für das Pessachfest. Siebenter und achter Tag, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.
· Gebetbuch für das Schluß- und Freudenfest, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.
· Gebetbuch für das Wochenfest, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.
· Gebetbuch für den Versöhnungsabend, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.
· Gebetbuch für den Versöhnungstag, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.
· Sidur. Sefat emet. Gebete der Israeliten, Selig Pinchas haLevi Bamberger, Rödelheim 1903; 1923; herausgegeben von Wolf Heidenheim, Rödelheim 1933; Gebetbuch der Israeliten, Basel 1986. Im Hebräischen ist siddūr (Ordnung) das jüdische Gebetbuch für Alltag und Schabbat, sefáṯ ǣmæṯ bedeutet: Sprache der Wahrheit.
· Kaddisch. Gebete und Gebräuche für die Seelengedächtnisfeier und für die Trauerzeit, M. J. Beihoff, Düsseldorf 1990.
· Der jüdische Gottesdienst. Gestalt und Entwicklung, Leo Trepp, Stuttgart, Berlin und Köln 1994; 2004.
· Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung, Ismar Elbogen (1874-1943), Leipzig 1913; Frankfurt am Main 1924; 1931; Hildesheim, Zürich und New York 1995.
· Das Buch der jüdischen Jahresfeste, Efrat Gal-Ed, Insel-Taschenbuch, Nr. 2697, Frankfurt am Main und Leipzig 2001.
· Methodisch geordnetes Wörterbuch zu einer Auswahl hebräischer Gebete und Psalmen nebst einem alphabetischen Wörterverzeichnis und einer hebräischen Grammatik, Michael Abraham, Frankfurt am Main 1918; 1925.
· Schaʿre Zedeq. Eine methodische Einführung in die Sprache der Bibel und des Gebetbuches, Michael Abraham, Neubearbeitung von Tefilla Kezara und Schaʿare Thora, Frankfurt am Main 1934.
Volksbücher
· Der Born Judas. Legenden, Maͤrchen und Erzaͤhlungen, Micha Josef bin Gorion (Berdyczewski; 1865-1921), 6 Bände, Leipzig 1916-1923; Von Liebe und Treue. Vom rechten Weg. Maͤren und Lehren. Weisheit und Torheit. Volkserzaͤhlungen. Kabbalistische Geschichten.
· Der Born Judas. Altjüdische Legenden, Übersetzung von Rahel bin Gorion (Ramberg; 1879-1955), Leipzig 1922.
· Der Born Judas. Märchen und Geschichten, herausgegeben und Nachwort von Emanuel bin Gorion (1903-1987), Übersetzung von Rahel bin Gorion, Berlin 1934.
· Der Born Judas. Legenden, Märchen und Erzählungen, Wiesbaden 1959; Frankfurt am Main 1973; 1981; 1993.
· Die Sagen der Juden. Jüdische Sagen und Mythen, Micha Josef bin Gorion, 5 Bände, Frankfurt am Main 1913f.1919.1926f: Von der Urzeit. Die Erzväter. Die zwölf Stämme. Mose. Juda und Israel.
Geschichte
Flavius
Josephus
· Der Jüdische Krieg, Hermann Endrös und Gerhard Wirth, München 1964; 1980; 1986.
· Geschichte des Jüdischen Krieges, Heinrich Clementz (1859-1946), Halle an der Saale 1900; Berlin 1923; Halle an der Saale 1924; Köln 1959; durchgesehen, Anmerkungen und Nachwort von Heinz Kreißig, Leipzig 1974; Wiesbaden 1978; Stuttgart 2015; Einleitung von Klaus-Dieter Eichler, Ditzingen 2019.
· Jüdische Alterthümer, Franz Kausen, 2 Bände, Köln 1852f.
· Jüdische Altertümer, Heinrich Clementz, 2 Bände, Köln 1899; Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Auslandes, Nr. 1329-1339; 1368-1380, 2 Bände, Berlin 1923; 1924, Köln 1959; in einem Band: Wiesbaden 1979; 1985; 1987; 1989; 1990; 1993; 1994.
· Kleinere Schriften: Selbstbiographie. Gegen Apion. Über die Makkabäer, Heinrich Clementz, Halle an der Saale 1901; Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Auslandes, Nr. 1466-1470, Berlin 1924; Köln 1960; Wiesbaden 1993.
· Opera recognovit Benedictus Niese (Jürgen Anton Benedikt Niese; 1849-1910), 7 Bände, Berlin 1888-1895; Wiesbaden 2004.
Jüdische
Geschichte
· Jüdische Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart, Matthias B. Lehmann, München 2025.
· Masada. From Jewish Revolt to Modern Myth, Jodi Magness, Princeton, New Jersey und Oxford 2019; Masada. Der Kampf der Juden gegen Rom, Übersetzung von Thomas Bertram, Darmstadt 2020.
Philosophie und Welt des Geistes
Theodor W. Adorno (Theodor Ludwig Wiesengrund)
· Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, mit Max Horkheimer, Amsterdam 1947; Frankfurt am Main 1988.
· Gesammelte Schriften, Rolf Tiedemann, Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz, 20 Bände in 23 Büchern, Frankfurt am Main 1970-1980; 1997; Darmstadt 1998.
· Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie, Frankfurt am Main 1964.
· Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen, Tübingen 1933.
· Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Berlin und Frankfurt am Main 1951.
Hannah Arendt
· The Origins of Totalitarianism, New
York 1951; Elemente und Ursprünge
totaler Herrschaft, Frankfurt am Main 1955.
Walter
Bendix Schoenflies Benjamin
· Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, Bern 1920; Hamburg 2022.
· Gesammelte Schriften, Theodor W. Adorno, Gershom Scholem, Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, 17 Bände, Frankfurt am Main 1972-1999; 14 Bände, Frankfurt am Main 1991 (in dieser Ausgabe fehlen die drei Supplementbände).
· Gesammelte Werke, 2 Bände, Frankfurt am Main 2011; Zweitausendundeins Klassiker-Bibliothek, 2023.
· Kapitalismus als Religion (1921), herausgegeben von Dirk Baecker, Berlin 2003.
Ernst Simon
Bloch
· Atheismus im Christentum, Frankfurt am Main 1968.
· Avicenna und die aristotelische Linke, Leipzig 1949; Berlin 1952.
· Das Prinzip Hoffnung, 3 Bände, Berlin 1954f.1959; 2 Bände, Frankfurt am Main 1959; 3 Bände, Frankfurt am Main 1968; 1990; 1993.
· Geist der Utopie, München 1918; Berlin 1923.
· Kritische Erörterungen über Heinrich Rickert und das Problem der modernen Erkenntnistheorie, Dissertation, Würzburg 1909; Ludwigshafen.1909.
· Thomas Müntzer als Theologe der Revolution, München 1921.
· Werkausgabe, 16 Bände, Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main 1985.
Martin
Mordechai Buber
· Der Glaube der Propheten, Zürich 1950; Heidelberg 21984.
· Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 1949; 2014.
· Gog und Magog. Eine Chronik, Heidelberg 1949; Gütersloh 2009.
· Ich und Du, Leipzig 1923; Nachwort und Anmerkungen von Bernhard Lang, Heidelberg 1983; Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 14171, Ditzingen 2021.
· Zwei Glaubensweisen, Zürich 1950; Nachwort von David Flusser und Anhang von Lothar Stiehm, Darmstadt 21989.
Elias Canetti
· Masse und Macht, Hamburg 1960; 1992.
Ernst Alfred Cassirer
· Philosophie der symbolischen Formen, zusammen mit Hermann Noack, 3 Bände, Berlin 1923.1925.1929; Birgit Recki und Claus Rosenkranz, Gesammelte Werke, Band 12, Teil 1-3, Hamburg 2002; Meiners philosophische Bibliothek, Band 607-609, Hamburg 2010; 2023.
· Gesammelte Werke, Birgit Recki, Friederike Plaga, Claus Rosenkranz, Tobias Berben, Dagmar Vogel, Reinhold Schmücker, Julia Clemens, Ralf Becker und Marcel Simon, 25 Bände und ein Registerband, Hamburg und Darmstadt 1998-2009.
Sigmund
(Sigismund Schlomo) Freud
· Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, Leipzig 1921; Der Humor, herausgegeben von Ilse Grubrich-Simitis, Edition Sigmund Freud. Werke im Taschenbuch, 1992; Einleitung von Peter Gay, Fischer Klassik, Frankfurt am Main 2009; 52020; Hamburg 2022.
· Die endliche und die unendliche Analyse Berlin 1937; 2021.
· Die Zukunft einer Illusion, Leipzig 1927; Gesammelte Werke, Band 7, Berlin 22021.
· Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker. Vier Aufsätze, in: Imago 1912f; Totem und Tabu, Wien 1913; Leipzig, Wien und Zürich 1925; Totem und Tabu. Das Unbehagen in der Kultur (1930), Köln 2010.
· Massenpsychologie und Ich-Analyse. Die Zukunft einer Illusion, Einleitung von Reimut Reiche, London 1940; 1948; Fischer-Taschenbuch, Nr. 10452, Frankfurt am Main 1993; 82007.
Salomo ben Jehuda ibn Gabirol
· Fons vitæ. Lebensquelle Kapitel I und II, Ottfried Fraisse, Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters, Band 21, Freiburg im Breisgau, Basel und Wien 2009.
· Krone des Königtums, Eveline Goodman-Thau, Christoph Schulte, Christoph Correll und Karl E. Grözinger, Jüdische Quellen, Band 3, Berlin 1994.
Yuval Noah Harari
· Nexus. Eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke von der Steinzeit bis zu der künstlichen Intelligenz, Jürgen Neubauer und Andreas Wirthensohn, München 2024.
· Renaissance Military Memoirs. War,
History and Identity, 1450-1600, Dissertation, Woodbridge, Suffolk 2004.
· The Ultimate Experience. Battlefield
Revelations and the Making of Modern War Culture, 1450-2000, Basingstoke,
Hampshire 2008.
Etty Hillesum
· Het denkende hart van de barak. De
brieven, Haarlem 1982; Amsterdam 1994; 112009.
· Het verstoorde leven. Dagboek 1941-1943, zusammengestellt und eingeleitet durch Jan Geurt Gaarlandt, Haarlem 1981; Amsterdam 191989; 322011.
Max Horkheimer
· Anfänge der bürgerlichen Geschichtsphilosophie, Stuttgart 1930.
· Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, mit Theodor Adorno, Amsterdam 1947; Frankfurt am Main 1988.
· Gesammelte Schriften, Alfred Schmidt und Gunzelin Schmid Noerr, 19 Bände, Frankfurt am Main 1985-1996.
· Über Kants Kritik der Urteilskraft als Bindeglied zwischen theoretischer und praktischer Philosophie, Habilitationsschrift, Frankfurt am Main 1925.
Delphine Horvilleur
· Comment ça va pas ? Conversations après le 7 octobre, Paris
2024.
· Des mille et une façons dʼêtre juif ou musulman, mit Rachid Benzine, Paris
2917.
· En tenue dʼÈve.
Féminin, pudeur et judaïsme,
Paris 2013.
· Notarikon. The Rabbinic Art of
Word-breaking, New York 2008.
· Réflexions sur la question antisémite,
Paris 2019.
Sarah Kofman
· Camera obscura.
De lʼidéologie,
Paris 1973.
· LʼÉnigma de la femme. La femme dans les textes de Freud,
Paris 1980.
· Le mépris des juifs. Nietzsche, les juifs,
lʼantisémitisme,
Paris 1994.
· Rue Ordener, rue Labat, Paris 1994.
Jehuda ben Samuel haLevi
· Das Buch Al-Chazarî. Kitāb al-ḥazarī des Abu
l-Ḥasan Jehuda haLevi [1075-1141] im arabischen Urtext sowie in der
hebräischen Übersetzung des Jehuda ibn Tibbon, herausgegeben von Hartwig
Hirschfeld (1854-1934), Leipzig 1887; Das Buch Al-Chazarî, Aus dem Arabischen
des Abu l-Ḥasan Jehuda haLevi, Wiesbaden 2000.
Rosa Luxemburg (Rozalia Luxenburg)
· Gesammelte Werke, 7 Bände, Berlin 1970-1975.
· Militarismus, Krieg und Arbeiterklasse, Frankfurt am Main 1914.
Moses Maimonides
(Moše ben Maimon)
· Das Buch der Erkenntnis, Chajim Sack, St. Petersburg 1850; Eveline Goodman-Thau, Christoph Schulte und Friedrich Niewöhner, Jüdische Quellen, Band 2, Berlin 1994.
· Der Brief in den Jemen. Texte zum Messias, Sylvia Powels-Niami, Helen Thein und Friedrich Niewöhner, Jüdische Geistesgeschichte, Band 1, Berlin 22005.
· Führer der Unschlüssigen, Adolf Weiß, 3 Bände, Meiners Philosophische Bibliothek, Band 184 a-c, Leipzig 1923f.
· Wegweiser für die Verwirrten. Eine Textauswahl zur Schöpfungsfrage. Arabisch/Hebräisch-Deutsch, Übersetzung von Wolfgang von Abel, Ilya Levkovich und Frederek Musall, eingeleitet von Frederek Musall und Youssef Schwartz, Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters, Band 19, Freiburg im Breisgau, Basel und Wien 2009.
Karl Marx
· Das Kapital. Buch I: Der Produktionsproceß des Kapitals, Hamburg 1867; Buch II: der Circulationsproceß des Kapitals, herausgegeben von Friedrich Engels, Hamburg 1885; Buch III: Der Gesammtproceß der kapitalistischen Produktion, herausgegeben von Friedrich Engels, 2 Bände, Hamburg 1894.
· Die britische Herrschaft in Indien. Die Ostindische Kompanie, ihre Geschichte und die Resultate ihres Wirkens. Die künftigen Ergebnisse der britischen Herrschaft in Indien, in: New York Daily Tribune 1853.
· Manifest der Kommunistischen Partei, zusammen mit Friedrich Engels, London 1848.
· Rußlands Drang nach Westen. Der Krimkrieg und die europäische Geheimdiplomatie im 19. Jahrhundert, zusammen mit Friedrich Engels, Nachwort von Lothar Rühl, Zürich 1991.
· Thesen über Feuerbach (1845), Stuttgart 1888.
· Zur Judenfrage, Paris 1843.
· Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Paris 1843.
Moses Mendelssohn
· Jerusalem oder Über religiöse Macht und Judentum, Berlin 1783; Mit dem Vorwort zu Manasse ben Israels Rettung der Juden und dem Entwurf zu Jerusalem, Michael Albrecht, Meiners philosophische Bibliothek, Band 565, Hamburg 2005; 2020.
· Phädon oder Über die Unsterblichkeit der Seele, Amsterdam 1767; Anne Pollok, Meiners philosophische Bibliothek, Band 505, Hamburg 2013.
Abraham
Isaak haKohen Qōq (Kook)
· Die Lichter der Tora, Eveline Goodman-Thau, Christoph Schulte, Timotheus Arndt und Joseph Dan, Jüdische Quellen, Band 4, Berlin 1995.
Baruch de Spinoza
·
Ethica, ordine geometrice demonstrata, Amsterdam
1677.
· Ethik, in geometrischer Ordnung dargestellt, herausgegeben, Übersetzung und Einleitung von Wolfgang Bartuschat, Sämtliche Werke, Band 2, Philosophische Bibliothek, Band 92, Hamburg 32010.
· Opera, herausgegeben von Carl Gebhardt (1881-1934), 4 Bände, Heidelberg 1925; Supplementa: Kommentar und Einleitung, herausgegeben von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg 1987.
· Tractatus politicus, Amsterdam 1677.
· Tractatus theologico-politicus, Amsterdam 1670.
· Politischer Traktat, herausgegeben, Übersetzung und Einleitung von Wolfgang Bartuschat, Sämtliche Werke, Band 5, 2, Philosophische Bibliothek, Band 95 b, Hamburg 22010.
· Theologisch-Politischer Traktat, herausgegeben, Übersetzung und Einleitung von Wolfgang Bartuschat, Sämtliche Werke, Band 3, Philosophische Bibliothek, Band 93, Hamburg 2012; 2018.
Ludwig Wittgenstein
· Tractatus logico-philosophicus, London 1922; Edition Suhrkamp, Nr. 12, Frankfurt am Main 1963; Brian McGuinness, Joachim Schulte und Heikki Nyman, Frankfurt am Main 1989; 382021.
· Werkausgabe, Brian McGuinness und Joachim Schulte, 8 Bände, Frankfurt am Main 1984; 1999-2011; 2019-2021.
Belletristik und andere Werke
Schmuel
Joseph Agnon
· Be-ḥanūtō šel mar Lublin, Jerusalem 1974; Herrn Lublins Laden, Inken Kraft, Leipzig 1993.
· Das Buch von den polnischen Juden, mit Ahron Eliasberg, Berlin 1916.
· Die Erzählung vom Toraschreiber, Max Strauß, Berlin 1923.
· Ha-nidaḥ, Berlin 1923; Der Verstoßene, N. N. Glatzer und Moritz Spitzer, Berlin 1938.
· Im Herzen der Meere und andere Erzählungen, Karl Steinschneider, Manesse-Bibliothek der Weltliteratur, Zürich 1966.
· In der Gemeinschaft der Frommen. Erzählungen, Gershom Scholem, Bücherei des Schocken-Verlags, Band 5, Berlin 1935.
· Liebe und Trennung. Erzählungen, Gerold Necker, Frankfurt am Main 1996.
· Sefer ha-maʽasīm, Jerusalem 1942; Das Buch der Taten. Erzählungen, Gerold Necker und Karl Steinschneider, Frankfurt am Main 1995; 1998.
· Ve-haya he-akov le-mišor, Jaffa 1912; Berlin 1919; Jerusalem 1966; Und das Krumme wird gerade, Max Strauß, Bücherei des Schocken-Verlags, Band 14, Berlin 1918; 1920; 1934.
Rose Ausländer (geborene Rosalie Beatrice
Scherzer)
· Der Traum hat offene Augen. Unveröffentlichte Gedichte 1965-1978, Helmut Braun, Frankfurt am Main 1987.
· Gesammelte Werke, Helmut Braun, 7 Bände, Frankfurt am Main 1984-1986.1988.1990.
Taffy (Stephanie) Brodesser-Akner
· Fleishman is in Trouble, New York
2019.
· Long Island Compromise, New York
2024.
Elias Canetti
· Das Buch gegen den Tod, Mit einem Essay von Peter von Matt, München 2014.
· Die Blendung.
Roman, Wien 1936.
· Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, Frankfurt am Main 1979.
Paul Celan
·
Der Sand aus den Urnen, Wien 1948.
Arthur Rimbaud, Georg Trakl, Franz Werfel, Alfred Margul-Sperber
und Rose Ausländer verwendeten in ihren Gedichten Ausdrücke und Bilder, die
Paul Celan in seiner Todesfuge
verarbeitete.
· Gesammelte Werke, Beda Allemann, 5 Bände, Frankfurt am Main 1983.
· Mohn und Gedächtnis, Stuttgart 1952.
Michael Chabon
· Moonglow, London 2016.
· The Amazing Adventures of Kavalier
& Clay. A Novel, New York 2000.
· The Yiddish Policemanʼs Union,
London 2007.
Deborah Feldman
· Exodus. A Memoir, New York 2014.
· Judenfetisch, München 2023.
· Überbitten, Zürich 2017.
· Unorthodox. The Scandalous Rejection
of My Hasidic Routs, New York 2012.
Lion Feuchtwanger
· Der falsche Nero, Amsterdam 1936.
· Die Jüdin von Toledo, Berlin 1955.
· Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis, Stockholm 1952.
· Jud Süß. Roman, München 1925.
Jonathan
Safran Foer
· Everything is Illuminated. A Novel,
New York 2003.
· Extremely Loud & Incredibly
Close. A Novel, Boston 2005.
· Here I Am, New York 2016.
· Tree of Codes, London 2010.
Louise
Elisabeth Glück
· Ararat, New York 1990.
· Averno, New York 2006.
· Faithful and Virtuous Night, New
York 2014.
· Firstborn, New York 1968.
· Marigold and Rose. A Fiction, New
York 2022.
· The House on Marshland, New York
1975.
· The Seven Ages, New York 2001.
· The Triumph of Achilles, New York
1985.
· The Wild Iris, New York 1992.
· Vita Nova, New York 1999.
· Winter Recipes from the Collective,
New York 2021.
David Grossman
· ʼAyēn ʽērek: ʼahavā; Stichwort Liebe, Judith Brüll, München 1991.
· Die Kraft zur Korrektur. Über Politik und Literatur, Vera Loos und Naomi Nir-Bleimling, München 2008.
· Eine Frau flieht vor einer Nachricht. Roman, Anna Birkenhauer, München 2009.
· Ha-zemān haṣ-ṣāhov; Der gelbe Wind. Die israelisch-palästinensische Tragödie, Jürgen Benz, München 1988.
· Kommt ein Pferd in die Bar, Roman, Anne Birkenhauer, München 2016.
· Löwenhonig. Der Mythos von Samson, Vera Loos und Naomi Nir-Bleimling, Berlin 2006.
· Mišēhū larūṣ itō; Wohin du mich führst, Vera Loos und Naomi Nir-Bleimling, München 2001.
Christian Johannn Heinrich (Harry) Heine
· Atta Troll. Ein Sommernachtstraum, Hamburg 1847.
· Atta Troll. Ein Sommernachtstraum. – Deutschland. Ein Wintermärchen, herausgegeben von Joachim Bark, München 1979; Augsburg 2008; Stuttgart 2015.
· Buch der Lieder, Hamburg 1827 (Das bekannteste Lied ist die Loreley).
· Der Rabbi von Bacharach, in: Der Salon, vierter Teil, Hamburg 1840.
· Deutschland. Ein Wintermärchen, Hamburg 1844.
· Sämtliche Werke, Paul Stapf, 4 Bände, Basel 1956.
· Sämtliche Werke, Oskar Walzel, 10 Bände, Leipzig 1910-1920.
Dara Horn
· A Guide for the Perplexed, New York
2013.
· All Other Nights, New York 2009.
· People Love Dead Jews, New York
2021.
· The World to Come, New York 2006.
Franz Kafka
· Das Schloss. Roman, München 1926.
· Der Process, Berlin 1925.
· Die Verwandlung, Der Jüngste Tag, Leipzig 1916.
· Ein Hungerkünstler. Vier Geschichten, Berlin 1924.
Leslie Kaplan
· LʼAssassin du dimanche, Paris 2024.
· Les livre des Ciels, Paris 1983.
· Le pont de Brooklyn, Paris 1987; 1991.
· Les Amants de Marie, Paris 2002; 2004.
· Le Silence du diable, Paris 1991.
· Les Prostituées philosophes, Paris 1997.
· Le Psychanalyste, Paris 1999;
2001.
· LʼExcès – lʼusine, Paris 1982.
· Millefeuille, Paris 2012; 2014.
Etgar Keret
· Der Busfahrer, der Gott sein wollte, Barbara Linner, München 2001.
· Gaza Blues, Barbara Linner, München 2002.
· Starke Meinung zu brennenden Themen, Barbara Linner, Berlin 2025.
· Tuʼs nicht. Storys, Barbara Linner, Berlin 2020.
Ephraim Kishon (Ferenc Hoffmann)
· Arche Noah, Touristenklasse. Neue Satiren aus Israel, Übersetzung von Friedrich Torberg (1908-1979), München und Wien 1963.
· Auch die Waschmaschine ist nur ein Mensch. Die besten Technikgeschichten, Übersetzung von Axel Benning, Zeichnungen von Rudolf Angerer, München 1987.
· Der Blaumilchkanal. Satirische Szenen, Übersetzung von Friedrich Torberg, München und Wien 1971.
· Der Fuchs im Hühnerstall. Ein satirischer Roman, München und Wien 1969.
· Der Glückspilz. Satirischer Roman, München und Wien 2003.
· Drehn Sie sich um, Frau Lot! Satiren aus Israel, Übersetzung von Friedrich Torberg, München 1961.
· Kein Öl, Moses? Neue Satiren, Übersetzung von Friedrich Torberg, München und Wien 1974.
· Mein Kamm. Satirischer Roman, München und Wien 1997.
· Nicht so laut vor Jericho. Neue Satiren, Übersetzung von Friedrich Torberg, München und Wien 1970.
· …und die beste Ehefrau von allen, Übersetzung von Gerhard Bronner und Friedrich Torberg, München und Wien 1981.
Nicole Krauss
· Forest Dark, London 2017.
· Great House, London 2010.
· Man Walks into a Room, New York
2002.
· The History of Love, New York 2005.
Salcia Landmann
· Der jüdische Witz. Soziologie und Sammlung, Olten 1960; Zürich 1965; Olten und Gütersloh 1968; Gütersloh 1969; Olten 1970; Frankfurt am Main, Wien und Zürich 1976; Olten und Freiburg im Breisgau 1983; 1988; Stuttgart und München 1988; Düsseldorf 1999; Vorwort von Valentin Landmann, Ostfildern 2010; 2011.
· Jüdische Witze, Deutscher Taschenbuch-Verlag, Nr. 139; München 1962; 1963; 1964; 1970; 1972; 1973; 1975; 1977; 1978; 1979; 1980; 1983; 1984; 1986; 1987; 1989; 1990; 1992; 1994; 1996; Leipzig 2000; Deutscher Taschenbuch-Verlag, Nr. 21017, München 2007.
Else Lasker-Schüler
· Hebräische Balladen, Berlin 1913.
· Mein blaues Klavier. Neue Gedichte, Jerusalem 1943.
· Werke und Briefe. Kritische Ausgabe, Andreas B. Kilcher, Norbert Oellers, Heinz Rölleke und Itta Shedletzky, 11 Bände, Frankfurt am Main 1996-1998.2001-2005.2008-2010.
Primo Levi
· La chiave a stella, Turin 1978.
· La tregua, Turin
1963.
· Lʼultimo Natale di guerra, Mailand 1986.
· Se non ora, quando, Turin 1981.
· Se questo è un uomo, Turin 1947.
Elsa Morante
· Aracoeli, Turin 1982.
· La storia,
Turin 1974.
· Lʼisola di Arturo, Turin 1957.
· Menzogna e sortilegio,
Turin 1948.
Irène Némirovsky
· David Golder, Paris 1929.
· LʼAffaire Courilof,
Paris 1933.
· Les chiens et les loups, Paris 1940.
· Les feux de lʼautomne,
Paris 1957.
Amos Oz (Klausner)
· Habsorā ʽal pī Yehūdā (Evangelium nach Judas); Judas, Mirjam Pressler, Berlin 2015.
· Ḥarusē ha-ḥayim we-ha-mawet; Verse auf Leben und Tod, Mirjam Pressler, Frankfurt am Main 2008.
· Ladaʽat išāh; Eine Frau erkennen, Ruth Achlama, Frankfurt am Main 1991.
· Maqōm ʼaḥēr (Ein anderer Ort); Keiner bleibt allein, Nili Mirsky und Jörg Trobitius, Düsseldorf 1996; Ein anderer Ort, Ruth Achlama, Frankfurt am Main 2001.
Zahia Rahmani
· France, récit dʼune enfance,
Paris 2006 ; 2008.
· Moze, Paris 2003.
· Musulman, Paris 2005.
Moses Joseph Roth
· April. Die Geschichte einer Liebe, Berlin 1925.
· Barbara. Erzählung, in: Österreichs Illustrierte Zeitung, Wien, 14. April 1918.
· Das Spinnennetz. Roman (Fragment), in: Arbeiterzeitung. Wien 7. 10. - 6. 11. 1923.
· Der blinde Spiegel. Ein kleiner Roman, Berlin 1925.
· Der stumme Prophet, Nachwort von Walter Lenning, Köln 1966.
· Der Vorzugsschüler, in: Österreichs Illustrierte Zeitung, Wien, 10. September 1916; in: Die Erzählungen, Nachwort von Hermann Kesten, Köln 1973.
· Die Flucht ohne Ende. Ein Bericht. Roman, München 1925.
· Die Legende vom heiligen Trinker. Novelle, Amsterdam 1939.
· Die Rebellion. Roman, Berlin 1924.
· Hiob. Roman eines einfachen Mannes, Berlin 1930.
· Hotel Savoy. Ein Roman, Berlin 1924.
· Juden auf Wanderschaft. Essay, Berlin 1927; Köln 1976.
· Radetzkymarsch, Berlin 1932.
· Rechts und links. Roman, Berlin 1929.
· Werke, 6 Bände, Köln 1989-1991.
· Zipper und sein Vater. Roman, München 1928.
Nelly
(Leonie) Sachs
· Fahrt ins Staublose. Gedichte, Frankfurt am Main 1961.
· In den Wohnungen des Todes, Mit Zeichnungen von Rudi Stern, Berlin 1947.
· Werke. Kommentierte Ausgabe, Matthias Weichelt, Ariane Huml und Aris Fioretos, 4 Bände, Frankfurt am Main 2010f.
Scholem Alejchem (Scholem Jankew
Rabinowitsch)
· Der Fortschritt in Kasrilewke und andere alte Geschichten aus neuerer Zeit, Lithographien von Anatoli Kaplan, Berlin 1990.
· Methusalem. Die Geschichte eines Pferdes, Kaltnadelradierungen von Regine Grube-Heinecke, Berlin 1988; 1989.
· Tewje [Tobias] der milchiker; Die Geschichten Tewjes des Milchhändlers, Übersetzung von Alexander Eliasberg, Ostjüdische Bibliothek, Berlin und Wien 1921; 1922; 1923; Berlin 1955; Fiddler on the Roof. Anatevka. Musical, Buch von Josef Stein, 1964 in New York uraufgeführt; Anatewka, Martin Koller und Brigitte Haveresch, Illustrationen von Lukas Ruegenberg, Kevelaer 2006.
Kurt Tucholsky
· Ausgewählte Werke, Neu-Isenburg 2006.
· Ausgewählte Werke, Fritz J. Raddatz, 2 Bände, Die Bücher der Neunzehn, Band 128, 1 und 2, Reinbek 1971.
· Ausgewählte Werke, 6 Bände, Roland und Christa Links, Berlin 1956-1958.
· Das Lächeln der Mona Lisa, Berlin 1929.
· Der Zeitsparer. Grotesken, Berlin 1914.
· Lerne lachen ohne zu weinen, Berlin 1931.
· Schloß Gripsholm, Berlin 1931.
Jakob Wassermann
· Das Gänsemännchen, Berlin 1915.
· Das Gold von Caxamalca. Erzählung, Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 6900, Leipzig 1928.
· Der Fall Maurizius, Berlin 1928.
· Die Juden von Zirndorf, Berlin, Leipzig und München 1897; Nachwort von Gunnar Och, Deutscher Taschenbuch-Verlag, Nr. 12163, München 1996. (Über Schabbtai Zvi, 1626-1676, den Propheten von Smyrna).
Franz Viktor Werfel
· Das Lied von Bernadette. Roman, Stockholm 1941.
· Der veruntreute Himmel. Die Geschichte einer Magd, Stockholm 1939.
· Die vierzig Tage des Musa Dagh, 2 Bände (Das Nahende. Die Kämpfe der Schwachen), Berlin 1933.
· Stern der Ungeborenen. Ein Reiseroman, Stockholm 1946.
Carl Zuckmayer
· Der blaue Engel, Berlin 1930.
· Der fröhliche Weinberg. Lustspiel, Berlin 1925.
· Der Hauptmann von Köpenick. Ein deutsches Märchen, Berlin 1931.
· Des Teufels General. Drama, Stockholm 1945.
· Schinderjannes. Schauspiel, Berlin 1927.
Stefan Zweig
· Abschied von Rilke. Eine Rede, Tübingen 1927.
· Der Kampf mit dem Dämon. Hölderlin – Kleist – Nietzsche, Die Baumeister der Welt, Band 2, Leipzig 1925.
· Die gesammelten Gedichte, Leipzig 1924.
· Die
Heilung durch den Geist. Mesmer
– Mary Baker Eddy – Freud, Leipzig 1931.
· Drei Dichter ihres Lebens. Casanova – Stendhal – Tolstoi, Die Baumeister der Welt, Band 3, Leipzig 1928.
· Drei Meister. Balzac – Dickens – Dostojewski, Die Baumeister der Welt. Versuch einer Typologie des Geistes, Band 1, Leipzig 1920.
· Frans Masereel, Mit Arthur Holitscher, Berlin 1923.
· Maria Stuart, Wien 1935.
· Schachnovelle, Buenos Aires 1942.
· Sternstunden der Menschheit. Fünf historische Novellen, Insel-Bücherei, Nr. 167/2, Leipzig 1927; Zwölf historische Miniaturen, Stockholm 1943.
· Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam, Wien 1934.
· Ungeduld des Herzens. Roman, Stockholm und Amsterdam 1939.
Ruth Zylberman
· 209 rue Saint-Maur, Paris Xe.
Autobiographie dʼun
immeuble, Paris 2020.
· La Direction de lʼabsent,
Paris 2017.
· Le Septième jour dʼIsraël. Un kibboutz en
Galilée, mit Serge Moati, Paris 1996.
Einführungen
· Das Judentum, Michael Tilly, Wiesbaden 72018.
· Das Judentum. Eine kleine Einführung, Norman Solomon, Reclam-Sachbuch, Nr. 18653, Stuttgart 62009.
· Einführung in das Judentum, Jonathan Magonet, Berlin 2003.
· Judentum, Johann Maier, Studium Religionen, Uni-Taschenbuch, Band 2886, Göttingen 2007.
Nachschlagewerke
· Jüdisches Lexikon, Ein enzyklopädisches Handbuch des jüdischen Wissens, herausgegeben von Georg Herlitz und Bruno Kirschner, unter redaktioneller Mithilfe von Ismar Elbogen, Josef Meisl, Aron Sandler, Max Soloweitschik, Felix A. Theilhaber, Robert Weltsch und Max Wiener, 4 Bände in 5 Büchern, Berlin 1927-1930.
· The Universal Jewish Encyclopedia, herausgegeben von Isaac Landman und Louis Rittenberg, 11 Bände, New York 1939-1944.
· Neues Lexikon des Judentums, Julius H. Schoeps, Willi Jasper, Bernhard Vogt und Olaf Glöckner, Gütersloh 1992; 1998; 2000.
· Philo-Lexikon. Handbuch des jüdischen Wissens, Berlin 1936; Frankfurt am Main 1992; 2003.
Modernhebräische Bibliographie
Modernhebräische Lehrbücher
o Blohm, Dieter, und Rachel Stillmann, Modernes Hebräisch. Lehrgang für Anfänger, Wiesbaden 2000.
o Bornstein, David Josef, Einführung in das Hebräisch der gegenwart. Methodische Texte und Erläuterungen, Berlin 1927.
o Noyman, Eyal, Hebräisch mal Tacheles, Mainz 2023.
o Raveh-Klemkeבכיף , עברית Ivrit bekef (Hebräisch mit Spaß), Bremen 2010.
o Rosen, Aharon, Tausend Worte Hebräisch. Hebräisch für Sie. Sprechen, lesen, schreiben, Tel Aviv 1975; 1977: 1980; 1989; 1991; 1999.
o Rosengarten, Miriam, צעד צעד עברית Hebräisch Schritt für Schritt, Wiesbaden 2023.
o Simon, Heinrich, Lehrbuch der modernen hebräischen Sprache, Leipzig 1970; 1977; 1982; 1986; 1988.
o Tirkel, Eliezer, Hebräisch leicht gemacht, Tel Aviv 2007.
o
Tsipi, Ben Ami, Ulpan. Ivrit, Rosh ha-ayin 2012.
o Wiznitzer, Manuel, Langenscheidts praktischer Sprachlehrgang Hebräisch. Ein Standartwerk für Selbstlerner, Berlin 1996.
Modernhebräische
Grammatiken
o Zachmann-Czalomon, Isolde, Hebräische Sprache. Ein Handbuch, Eichenau 1998.
o Zachmann-Czalomon, Isolde, Modern-Hebräisch. Grammatisches Handbuch, Wiesbaden 2012.
Modernhebräische Wörterbücher
o
Alcalay,
Reuben (1907-1976), The Complete Hebrew-English and English-Hebrew Dictionary,
5 Bände, Tel Aviv 1959; 1962; 1965; 1981; 1991; 1996;
2000.2001.
o Lavi, Jaʽakov, Langenscheidt. Handwörterbuch Hebräisch, bearbeitet von Ari Philipp, Kerstin Klingelhöffer und Chanan Prinz, 2 Bände, Berlin, München, Wien, Zürich und New York 2008.
Modernhebräische Lernhilfen
o Baader, Fritz Hanok, Kurzwort- und Abkürzungslexikon Hebräisch, Schömberg-Langenbrand 1999.
o Tarmon, Ascher, und Esri Uval, Tabellen der hebräischen Verben, Jerusalem 1971; 1978; 1991; 1998; 2010.
o Zachmann-Czalomon, Isolde, Das Verb im Modern-Hebräischen, Wiesbaden 1995.
Modernhebräische
Textbücher
· Hebrew Primer Reading Book for the
Israelitish Youth, S. Bär, Rodelheim 1898.
· Hebrew Reader, Ivor A. Richards
(1893-1980), David Weinstein und Christine Gibson, A Cardenal Edition, Band
171, New York 1955.
· Modern Hebrew Literature Reader for
Advanced Students, 2 Bände, New York 1971.
· Newspaper Hebrew Reader, Menahem
Mansoor (1911-2001), New York 1971.
Semitische Sprachen
· Bergsträßer, Gotthelf (1886-1933), Einführung in die semitischen Sprachen. Sprachproben und grammatische Skizzen, im Anhang: Zur Syntax der Sprache von Ugarit von Carl Friedrich Brockelmann, München 1928; Ismaning 1975.
·
Brockelmann, Carl Friedrich, Grundriß der
vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, 2 Bände, Berlin 1908.1911;
Hildesheim, Zürich und New York 1961; 1999; Vignate
2023.
· Brockelmann, Carl Friedrich, Semitische Sprachwissenschaft, Leipzig 1906.
· Hetzron, Robert (1937-1997), The Semitic
Languages, Routledge Language Family Description, London 1997.
· Huehnergard, John, und Naʻaman Pat-El,
The Semitic Languages, London und New York 2020.
· Kienast, Burkhart (1929-2014), Erhart Graete und Gene B. Graga, Historische semitische Sprachwissenschaft, Wiesbaden 2001.
· Lindberg, O. E., Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen. Lautlehre, Göteborg 1897; Norderstedt 2017.
· Moscati, Sabatino, und Anton Spitaler, An Introduction to the comparative Grammar of the
Semitic Languages, Phonology and Morphology, Wiesbaden 1964; 31980.
· Nöldeke, Theodor, Die semitischen Sprachen. Eine Skizze, Leipzig 1887; Leipzig 1899; Breslau 2016.
· Orel, Vladimir E., und Olga Stolbova, Hamito-Semitic Etymological Dictionary. Materials for a Reconstruction, Handbuch der Orientalistik, Erste Abteilung: Der Nahe und Mittlere Osten, 18. Band, Leiden, New York und Köln 1995.
· Stempel, Reinhard, Studien zur Rekonstruktion des Protosemitischen, Habilitationsschrift, Bonn 1993; Abriß einer historischen Grammatik der semitischen Sprachen, Nordostafrikanisch-westasiatische Studien, Band 3, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris und Wien 1999.
· Weninger, Stefan, The Semitic Languages. An International Handbook, Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Band 36, Berlin und Boston 2011.
· Zimmern, Heinrich, Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen, Porta linguarum orientalium, Band 17, Berlin 1898.
Jiddisch
Jiddisch
allgemein
· Birnbaum, Salomo Ascher (1891-1989), Das hebräische und aramäische Element in der jiddischen Sprache, Dissertation, Würzburg 1921; Leipzig 1922; Hamburg 1986.
· Landmann, Salcia (1911-2002), Jiddisch. Das Abenteuer einer Sprache. Mit kleinem Lexikon jiddischer Wörter und Redensarten sowie jiddischer Anekdoten, Olten und Freiburg im Breisgau 1962; Wiesbaden und München 1979; Ullstein-Materialien, Ullstein-Buch, Nr. 35240, Frankfurt am Main und Berlin 1986.
Jiddische
Lehrbücher
· Aptroot, Marion, und Holger Nath, Einführung in die jiddische Sprache und Kultur, Hamburg 2002.
· Lockwood, W. B., Lehrbuch der modernen jiddischen Sprache. Mit ausgewählten Lesestücken, Hamburg 1995.
Jiddische
Grammatiken
· Birnbaum, Salomo Ascher, Praktische Grammatik der jiddischen Sprache für den Selbstunterricht. Mit Lesestücken und einem Wörterbuch, Bibliothek der Sprachenkunde. Die Kunst der Polyglottie, 128. Teil, Wien und Leipzig 1918; Grammatik der jiddischen Sprache. Mit einem Wörterbuch und Lesestücken, Hamburg 1966; 1979; 1984; 1988.
· Birnbaum, Salomo Ascher, Yiddish. A
Survey and a Grammar, Toronto 1979; 2016.
Jiddische
Wörterbücher
·
Niborski, Yitskhok und Eliezer, sowie Simon
Neuberg,
ייִדיש ווערטר אין
לשון־קודש־שטאַמיקע פֿון
ווערטרבוך
Dictionnaire des mots dʼorigine
hébraïque
et araméenne en usage dans la langue yiddish, Paris 21999.
· Niborski, Yitskhok, und Simon Neuberg, Dictionnaire
Yiddish-Français,
Paris 2002.
· Wolf, Siegmund Andreas, Jiddisches Wörterbuch. Wortschatz des deutschen Grundbestandes der jiddischen (jüdischdeutschen) Sprache mit Leseproben, Mannheim 1962; Hamburg 1986; 1993.
Jiddische
Texte
· Birnbaum, Salomo Ascher, Die jiddische Sprache. Ein kurzer Überblick und Texte aus acht Jahrhunderten, Hamburg 1974; 1997.
· Jaldati, Lin, Eberhard Rebling und Heinz Kahlau, Es brennt, Brüder, es brennt. Jiddische Lieder, Berlin 21969.
· Schack, Ingeborg-Liane, Der Mensch tracht un Got lacht. 450 jiddische Sprichwörter. Auswahl, Umschrift, Übersetzung, Analyse und Einführung in die jiddische Sprache und Literatur, Mainz 1977.
Jiddische
Lernhilfen
· Birnbaum, Salomo Ascher, Yiddish
Phrase Book, London 1945.
· Weiss, Karin, Dorothea Greve und Smadar Raveh-Klemke, Der alef-bejs. Trit bay trit. Jiddisch lesen und Schreiben lernen, Bremen 2013; 2015.
Rotwelsch
Im Narrenschiff von 1494 wird die Sprache und der Charakter von Bettlern als rotwelsch bezeichnet. In der Folgezeit weitet sich dieser Begriff auf Fahrendes Volk, Gauner, Diebe und Nichtseßhafte aus. Zur Geheimhaltung der inneren Kommunikation und zur Stärkung des Zusammenhaltes entwickelte sich eine Sprache, die viele jiddische und hebräische Wörter aufnahm, da Juden von bürgerlichen Berufen weitgehend ausgeschlossen waren und daher häufig fahrende Händler sein mußten.
Einige Wortbeispiele:
¾ ausbaldowern, auskundschaften. Von hebr. ba‛al davar (jiddisch dover), Herr der Angelegenheit sein.
¾ Bock, Hunger, Gier. Von romani bokh, Hunger: Bock haben, Lust haben.
¾ Bulle, Polizist. Von niederländisch bol, kluger Kopf.
Rotwelsch-Wörterbücher
· Girtler, Roland, Rotwelsch. Die alte Sprache der Diebe, Dirnen und Gauner, Wien 1998.
· Günther, Louis, Die deutsche Gaunersprache und verwandte Geheim- und Berufssprachen, Leipzig 1919; Holzminden 2001.
· Siewert, Klaus, und Rudolf Post, Wörterbuch deutscher Geheimsprachen. Rotwelsch-Dialekte, Berlin und Boston 2023.
· Wolf, Siegmund A., Deutsche Gaunersprache. Wörterbuch des Rotwelschen, Mannheim 1956; Hamburg 1985; 1993.
Rotwelsch-Lehrbücher
· Puchner, Günter, Sprechen Sie Rotwelsch! 2.448 Wörter und Redewendungen der deutschen Gaunersprache, München 21975.
· Roth, Hansjörg, Barthel und sein Most. Rotwelsch für Anfänger, Frauenfeld 2007.
Historische Reisen durch das Heilige Land
· Pilger und Forscher im Heiligen Land. Reiseberichte aus Palästina, Syrien und Mesopotamien vom 11. bis zum 20. Jahrhundert in Briefen und Tagebüchern, Editha Wolf-Crome, Gießen 1977.
· Hermann Fürst von Pückler-Muskau, Die Rückkehr, 3 Theile, Berlin 1846 (Reisen nach Ägypten, Palästina und Syrien).
· Roberts, David, Rondreis door bijbelse landen, Sipke van der Land, Kampen 1981; Romantische Reise durch biblische Länder, Elly Grothof-Nouwen, Wuppertal 1981.
Kulturgeschichte
· Bedenke, vor wem du stehst! 300 Synagogen und ihre Geschichte in Westfalen und Lippe, Günter Birkmann und Hartmut Stratmann, unter Mitarbeit von Thomas Kohlpoth und Dieter Obst, Essen 1998.
· „Tuet auf die Pforten!“ Die Neue Synagoge 1866-1995, Hermann Simon und Oliver Bätz, Begleitbuch zur ständigen Ausstellung „Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum“, Berlin 1995.
· Wegweiser durch das jüdische Rheinland, Ludger Heid und Marina Sassenberg, Berlin 1992.
· Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jh.s v. Chr., Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, Band 10, Tübingen 1973.
· Jüdisch-christlicher Schulbetrieb in Alexandria und Rom. Literarische Untersuchungen zu Philo und Clemens von Alexandria, Justin und Irenäus, Johann Franz Wilhelm Bousset (1865-1920), Göttingen 1915; Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testamentes, Neue Folge, 6. Heft, Hildesheim, Zürich und New York 2004.
· The Jewish Book of Why, Alfred J. Kolatch, Middle Village, New York 1981; Le livre juif du pourquoi, Aus dem Amerikanischen ins Französische übersetzt und überarbeitet von Abraham Kokos, Genf 1990; Jüdische Welt verstehen. Sechshundert Fragen und Antworten, Aus dem Französischen übersetzt von Barbara Höhfeld, Überarbeitung der jüdisch-religiösen Begriffe von Schimon Or und Jörg Roggenbuck, Wiesbaden 1996; 1997; 2000; 2001; 2005; 2007; 2011; 2017.
· The Jews. A Treasury of Art and Literature, Sharon R. Keller, Southport, Connecticut 1992; Judentum in Literatur und Kunst, Übersetzung von Miriam Magali, Ursula Schmidt-Steinbach und Karl Hufschmidt, Köln 1995.
· The Archeology
of Jerusalem. From the Origins to the
Ottomans, Katharina Galor und Hanswulf Bloedhorn, New Haven, Connecticut und London 2013.
· The Architecture of Herod, the Great Builder, Ehud Netzer
und Rachel Laurey-Chachy, Grand Rapids, Michigan
2006.
· Eine Ahnung vom Paradies. Gärten in der Antike, Welt und Umwelt der Bibel 2022, Heft 4.
· 70 Jahre Qumran. Die Schriften vom Toten Meer, Welt und Umwelt der Bibel 2018, Heft 1.
· Heilige Räume. Tempel – Kirchen – Synagogen, Welt und Umwelt der Bibel 2022, Heft 1
· Rabbinisches Judentum und frühes Christentum, Welt und Umwelt der Bibel 2023, Heft 3.
· Die Samaritaner. Der unbekannte Teil Israels, Welt und Umwelt der Bibel 2021, Heft 2.
· Teufel und Dämonen. Verführer, Ankläger, Gegenspieler, Welt und Umwelt der Bibel 2012, Heft 2.
Landeskunde
· Das Heilige Land. Ein 10.000 Jahre altes Kulturland zwischen Mittelmeer, Rotem Meer und Jordan, Erhard Gorys, DuMont Kunst-Reiseführer, Köln 121995.
· Gaza. Brücke zwischen Kulturen. 6000 Jahre Geschichte, Mamoun Fansa und Karen Aydin, Ausstellung in Oldenburg, Mainz 2010.
· Heiliges Land, Marianne Mehling, Knaurs Kulturführer, München 1986.
· I Saw Ramallah, Mourid Barghouti, Übersetzung von Ahdaf Soueif, London 2005.
· Israel. Palästina. Das Heilige Land, Michel Rauch, DuMont-Bildatlas, Ostfildern 2012.
· Jaffa. Tor zum Heiligen Land, Martin Peilstöcker, Jürgen Schefzyk und Aaron A. Burke, Mainz 2013.
· Orte und Landschaften der Bibel. Ein Handbuch und Studien-Reiseführer zum Heiligen Land, Band I: Geographisch-geschichtliche Landeskunde; Band II: Der Süden, Othmar Keel, Max Küchler, Christoph Uelinger und Urs Staub, Einsiedeln, Zürich, Köln und Göttingen 1982.1984; Band IV, 1: Die Geschichte Jerusalems und die Entstehung des Monotheismus, Otmar Keel, Göttingen 2007; Band IV, 2: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt, Max Küchler, Göttingen 2007.
Schoa
Schoa (שואה šōʼāh) ist das hebräische Wort für das große Unheil; Holocaust steht für vollständig verbrannt.
Die Zugrampe in Auschwitz-Birkenau, aufgenommen durch Stanisław Mucha im Februar/März 1945
· Auschwitz. Geschichte und Nachgeschichte, Beckʼsche Reihe, Nr. 2333, München 2004.
· Der Holocaust. Ergebnisse und neue Fragen der Forschung, Frank Bajohr und Andrea Löw, Frankfurt am Main 2015.
· The Destruction of the European Jews, Raul Hilberg, 3 Bände, Dissertation, Chicago 1961; 1967; New York 1973; 1985; New Haven und London 2003; Die Vernichtung der europäischen Juden. Die Gesamtgeschichte des Holocaust, Übersetzung von Christian Seeger, Harry Maòr, Walle Bengs und Wilfried Szepoan, herausgegeben von Ulf Wolter, Berlin 1982; Frankfurt am Main, Olten und Wien 1982f; Frankfurt am Main 1990; Fischer-Taschenbuch, Nr. 10611-10613, 1999; Vorwort von René Schlott, Frankfurt am Main 1923.
Herzlichen Dank an Cornelia Attolini, welche während der langen Entstehungszeit dieser Netzseite stets großes Interesse zeigte und wertvolle Anregungen gab.
© Dr. Heinrich Michael Knechten, Stockum 2025